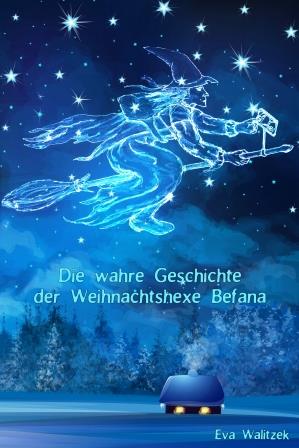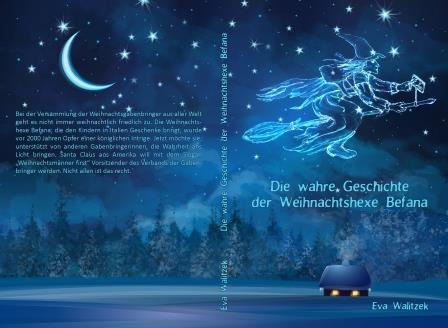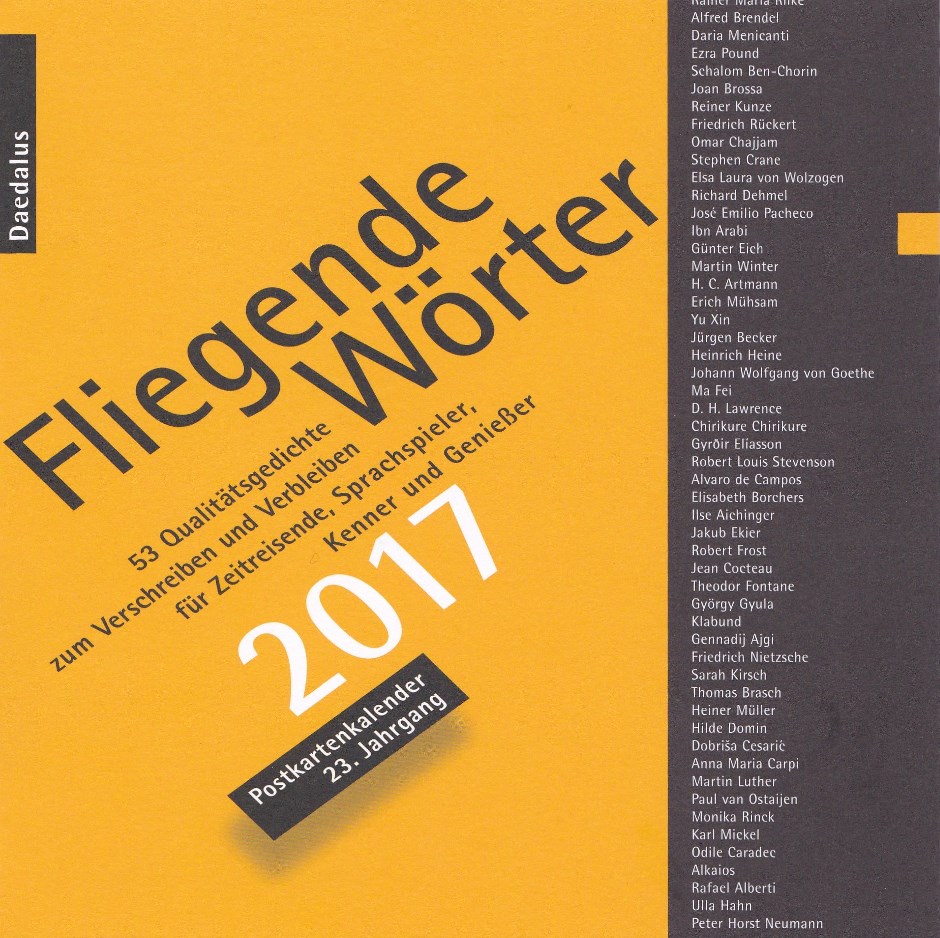In diesem Jahr wollte der Winter erst nicht kommen, jetzt will er nicht mehr weichen. Gestern Nacht bin ich unter funkelnden Sternen eingeschlafen – herzliche Grüße an Stephen Hawkins -, als ich heute Morgen, am offiziellen Frühlingsbeginn, aufwachte, war das Dachfenster zugeschneit. Am Wochenende haben uns die Schneemassen – immerhin 8 cm Neuschnee und etwa 5 Grad Minus – eine abenteuerliche Fahrt zur Buchmesse nach Leipzig beschert.
Gut 70 Minuten stand unser Zug am Samstag in Köthen, denn im Hauptbahnhof von Leipzig ging nichts mehr. Weil die Weichen eingefroren waren, kamen und fuhren gar keine Züge mehr. Einige Mitfahrerinnen, die die Buchmesse nicht in erster Linie wegen der Bücher, sondern als CosplayerInnen besuchten, funktionierten das Abteil kurzerhand in einen Schminksalon um und verwandelten sich in Loki und andere fabelhafte Wesen.

Vielleicht hätte ich gewarnt sein sollen, denn immerhin reiste ich mit Loki, der, wie ich nachgelesen habe, im Film Thor ein Nachfahre der Eisriesen ist. Auf der Buchmesse kamen wir dann trotzdem an, drei Stunden später als geplant zwar und nach einer Fahrt in einer total überfüllten Straßenbahn.
Ob der junge Mann, der mit uns von Hannover bis Halle im gleichen Abteil gesessen hat, es bis zur Buchmesse schaffte oder ob er resigniert umkehrte, werde ich wohl nie erfahren. Denn in Halle trennten sich unsere Wege. Wir stiegen, wie alle Besucher/innen der Buchmesse, zunächst dort aus, weil die Schaffnerinnen es uns empfohlen hatten. Doch weil kein Schienenersatzverkehr in Sicht war, wählten meine Begleiterin – inzwischen halb Loki, halb Mensch – und ich dann den Weg über Leipzig Hauptbahnhof. Eine gute Wahl.
Für den jungen Mann hat sich die Fahrt nach Leipzig sicher nicht gelohnt, denn er hatte schon für den Nachmittag um 16 Uhr seine Rückfahrt nach Hannover fest gebucht. Die Zeit reichte, wenn überhaupt, gerade für eine Stippvisite bei der Buchmesse. Doch wahrscheinlich fuhren am Samstagabend die Züge ohnehin noch nicht – und vielleicht irrt er immer noch durch Leipzig.
Selbst am Sonntagnachmittag, als wir nach anderthalb Messetagen nach Hause wollten, wurden mehrere Züge zwischen Leipzig und Hannover storniert. Vom Hauptbahnhof wurden die Messebesucher mit Bussen gen Westen chauffiert, Loki entdeckte, dem Internet sei Dank, eine Verbindung vom Messebahnhof über Bitterfeld nach Hannover. Hier bewahrheitete sich die alte Weisheit, dass wenn etwas schiefgeht, es meist gründlich schiefgeht: Auch dieser Zug war nicht pünktlich. Wir wurden aus irgendeinem Grund über Hildesheim umgeleitet: Immerhin erreichten meine Begleiterin und ich nach einem Sprint noch unsere Anschlüsse und kamen wie geplant zu Hause an. Danke Loki.
Schön war es in Leipzig trotzdem. Ich mag die Buchmesse, auch wenn ich mir vorgenommen habe, im nächsten Jahr schon am Donnerstag oder Freitag zu fahren, bevor der große Ansturm vor allem der CosplayerInnen einsetzt. Sie verleihen der Buchmesse zwar ein besonderes Flair – es ist wirklich faszinierend zu sehen, wie Gestalten aus Büchern und Filmen lebendig werden. Doch manchmal gibt es zwischen Göttern, Elben und Jedis kaum ein Durchkommen und die Bücher geraten für mich ein bisschen zu sehr in den Hintergrund.

Eine tolle Unterkunft haben wir in Leipzig auch entdeckt. Die werde ich vielleicht im Sommer, wenn der letzte Schnee bestimmt geschmolzen ist, nutzen, um die Stadt endlich einmal kennen zu lernen.

Denn außer Bahnhof und dem Messegelände habe ich von Leipzig noch nichts gesehen. Ich setze die Stadt auf meine To-visit-Liste. Time to fly.
*frei nach Heinrich Bölls: Der Zug war pünktlich