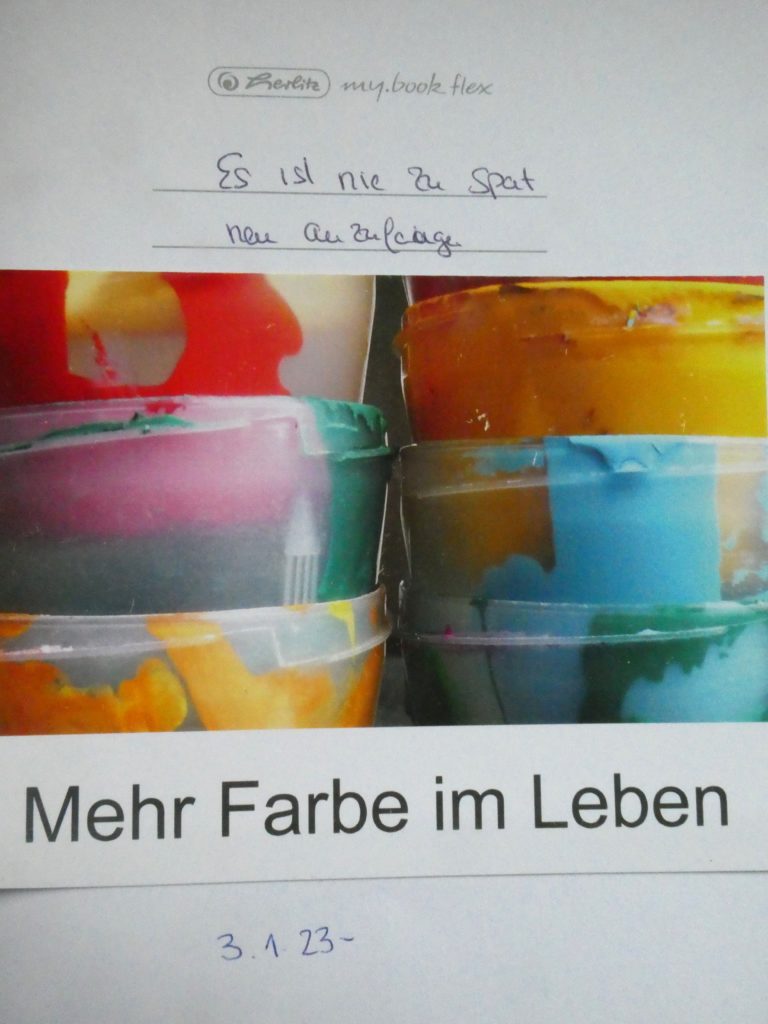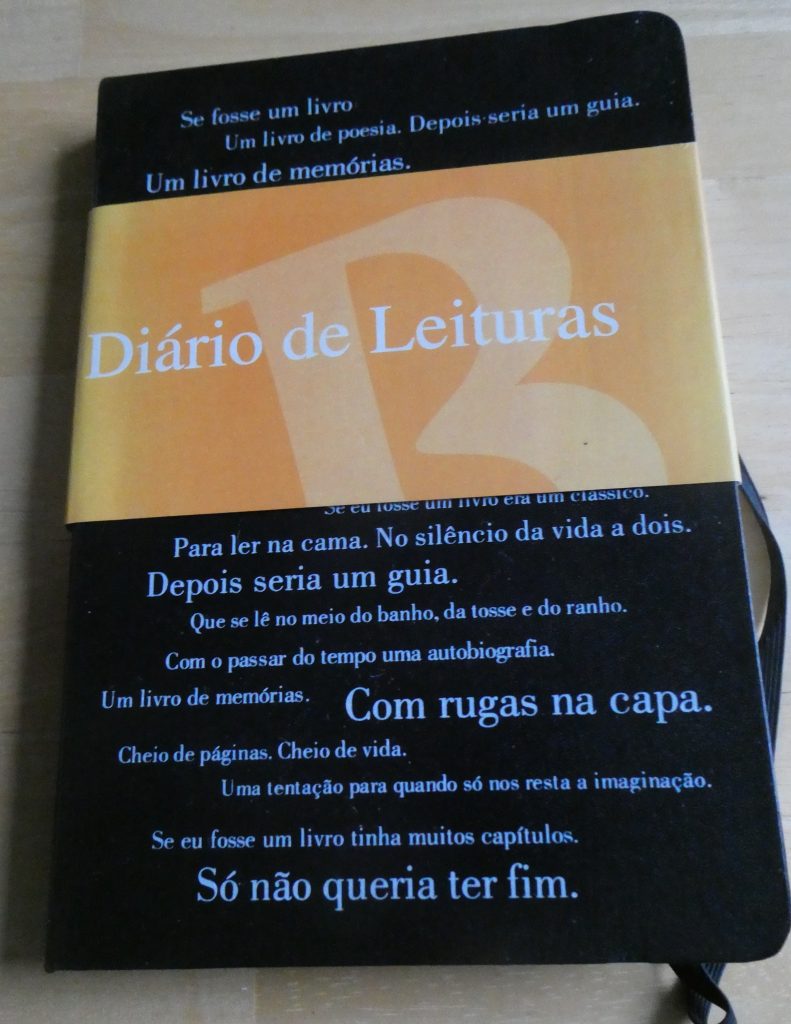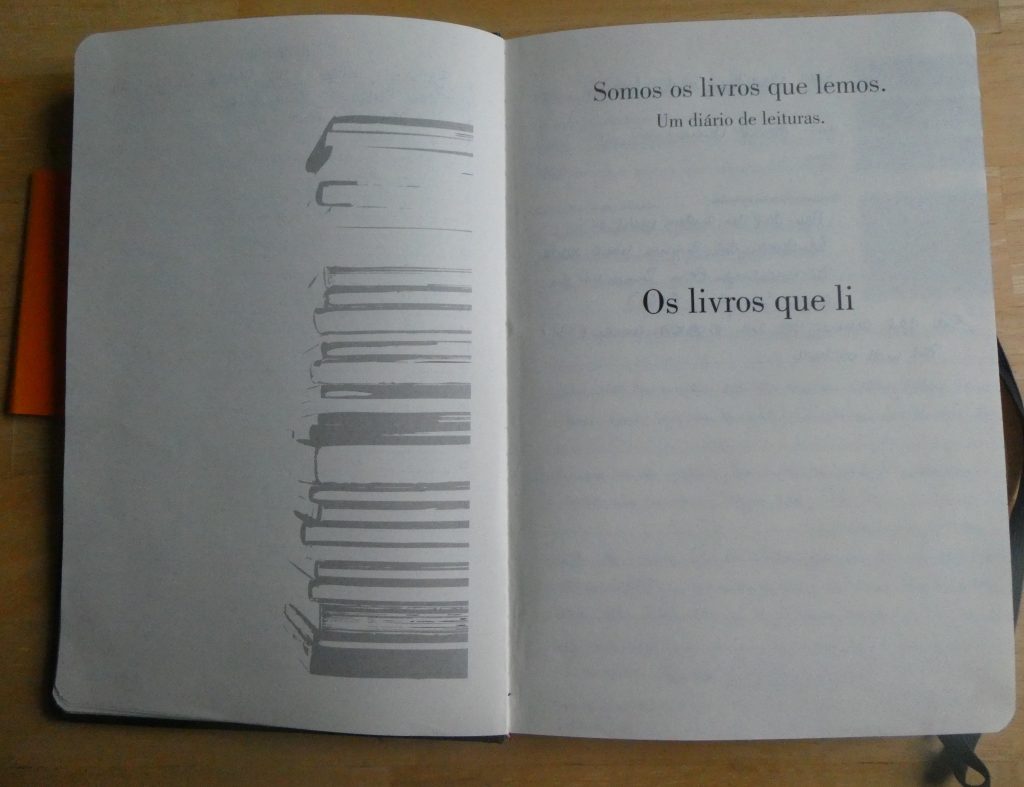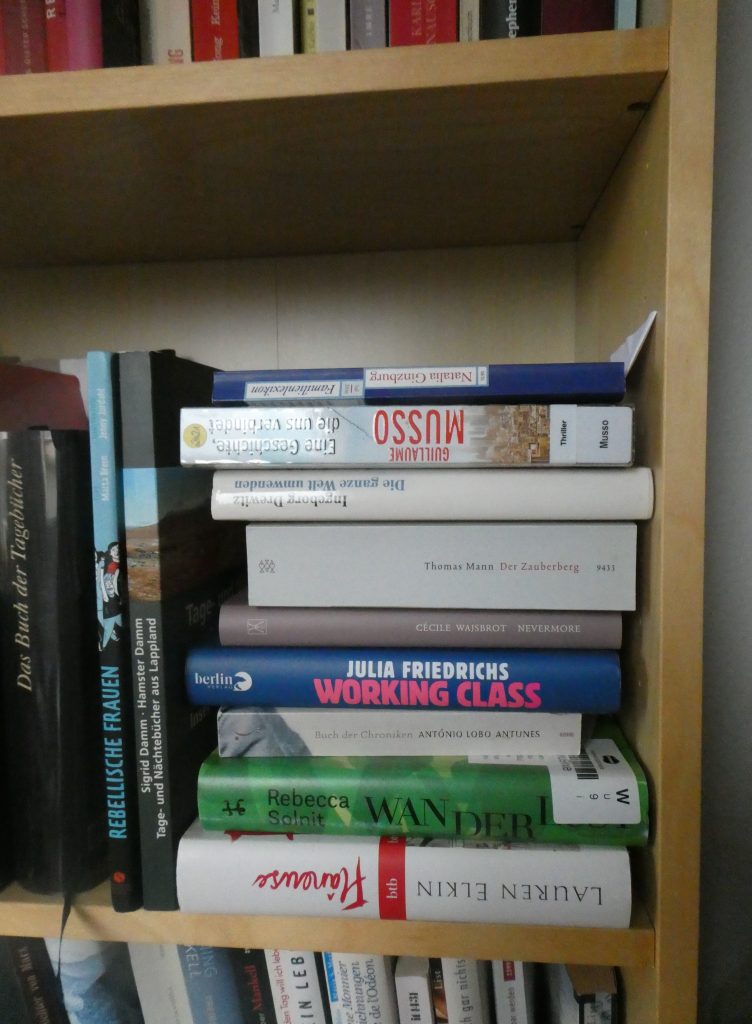Vor einem Jahr habe ich ein Hörgerät bekommen. Weil ich nicht nur, aber vor allem in großen Räumen manches schlecht, anderes gar nicht verstanden habe und den Fernseher immer öfter lauter drehen musste, hatte ich einen Termin bei der Hals-Nasen-Ohrenärztin gemacht. Wie erwartet empfahl sie mir ein Hörgerät, da mein Hörvermögen im Grenzbereich lag.
Wirklich begeistert war ich natürlich nicht. Denn Hörgeräte sind nicht billig – und selbst mit teuren Hörhilfen haben und hatten mehrere Bekannten große Probleme. Und auch Menschen, die zufrieden sind, brauchten meist einige Zeit, um sich an den Knopf im Ohr zu gewöhnen. Das gelingt, davon bin ich fest überzeugt, mit Ende sechzig sicher besser als in zehn Jahren, wenn dann ohne Hörgerät gar nicht mehr geht. Also besser jetzt als später.
Vor allem aber schreckte mich der Zusammenhang zwischen Altersschwerhörigkeit und Demenz, den verschiedene Studien belegen. Möglicherweise werden nämlich bei Menschen, die schwer hören und sich deshalb ständig konzentrieren müssen, andere Hirnfunktionen, vor allem die Hirnrinde und der Hippocampus, die Schaltstelle zwischen Kurzzeit- und Langzeitgedächtnis, vernachlässigt und geschwächt. Und da sind für mich Hörgeräte definitiv das kleinere Übel.
Auf den Termin bei der Hals-, Nasen- Ohrenärztin hatte ich mehr als zwei Monate gewartet, bis zu meinem ersten Besuch bei einem großen Akustiker vor Ort dauerte es dann noch einmal etwa sechs Wochen. Weil kein passendes Probegerät frei war, war es dann erst kurz vor Weihnachten so weit.
Gegen das Hörgerät selbst war eigentlich nichts einzuwenden, doch leider ließ es sich nicht wie geplant über die App des Herstellers mit meinem Smartphone verbinden. Das war jedoch für mich ein wichtiges Kriterium, weil ich – vor allem wenn ich unterwegs bin – über die Hörgeräte telefonieren oder Musik hören möchte. Außerdem war und ist mir die Bedienung über die winzigen Knöpfe an den beiden Hörgeräten auf Dauer viel zu fummelig.
Die Akustikerin, die mich betreute, mutmaßte, dass die Steuerung via Smartphone nicht funktioniert, weil mein in die Jahre gekommenes Telefon nicht mit der App kompatibel sei. Die Erklärung schien mir plausibel, denn seit ich die App installiert hatte, stürzte mein Smartphone immer wieder ab und verweigerte schließlich ganz den Dienst. Doch auch mit dem neuen Smartphone wurde es nicht viel besser, obwohl es auf der Liste der mit dem Hörgerät kompatiblen Mobiltelefone stand. Zwar gab es keine Systemabstürze mehr, aber immer, wenn ich Musik hörte, eine WhatsApp-Nachricht oder ein Anruf kam, schaltete die App vom Standard- in ein Streamingprogramm um. Die Wiedergabe wurde dann für Sekunden unerträglich laut, so dass die Hörgeräte meinem Gehör auf Dauer eher geschadet als genutzt hätten. Bei Musik oder Instagram-Beiträgen ließ sich die Lautstärke oft gar nicht regulieren: Mir blieb meist nur die Wahl zwischen extrem laut und stumm.
Die MitarbeiterInnen der Filiale empfahlen mir unter anderem, mein gerade mühsam neu eingerichtetes Smartphone auf die Werkseinstellung zurückzusetzen. Auch teurere Hör- oder Zusatzgeräte könnten Abhilfe schaffen, meinten sie. Die IT-ExpertInnen des Unternehmens, die sie um Rat fragten, konnten auch nicht weiterhelfen: Sie hatten angeblich noch nie von solchen Problemen gehört. Bei allen anderen funktioniere die App reibungslos, behaupteten sie.
Diese Aussage ärgerte mich im Nachhinein am meisten. Denn als ich recherchierte, merkte ich bald, dass mein Smartphone und ich nicht die einzigen waren, die sich mit der App nicht verstanden. Im Google Appstore erhielt die App gerade mal 2,4 Sterne: Ein Stern war die am häufigsten vergebene Bewertung – und einige KundInnen vergaben den einen Stern nur, weil Null-Sterne-Bewertungen nicht möglich sind. Die Kritiken – unter anderem „Schrott“, „(völlig) unbrauchbar“ und „unausgereift“ – waren teilweise wirklich vernichtend. Zufrieden waren vor allem die BesitzerInnen von iPhones.
Weil keine Lösung des Problems in Sicht war, wechselte ich nach vier Monaten frustriert den Anbieter: Ich lief zunächst zwei Wochen mit einem Diagnosegerät durchs Leben, das meine alltäglichen Hörsituationen aufzeichnete. Dann testete ich ebenso lange ein Probegerät – und kam damit gut zurecht. Doch bevor sie den Antrag bei der Krankenkasse einreichen konnte, hatte zunächst die Hörgeräteakustikerin, die mich betreute, einen Unfall und war krankgeschrieben. Dann stürzte ich in Norwegen und konnte zwei Monate lang ziemlich immobil. Als ich wieder besser laufen konnte, war die Verordnung abgelaufen und ein neuer Besuch bei der Hals-Nasen-Ohrenärztin nötig. Und so dauerte es bis August, bis ich endlich das Hörgerät bekam, das mich vermutlich die nächsten sieben Jahre begleiten wird. Denn erst dann wird sich meine Krankenkasse wohl an den Kosten für ein neues Hörgerät beteiligen.


Vorläufig ungelöst bleibt wohl das Problem mit meinen Gehörgängen. Dass sie sehr eng sind, hat mich fast siebzig Jahre lang nicht gestört. Doch obwohl die Hörgeräte sehr klein sind, animieren sie jetzt offensichtlich die Ceruminal- und Talgdrüsen im Ohr, mehr Ohrenschmalz zu produzieren. Und so bildet sich leider immer wieder ein Pfropf, der dann den Gang zwischen Ohrmuschel und Trommelfell verstopft. Das fühlt sich an wie Watte oder Wasser im Ohr und ich höre dann trotz Hörgeräten schlecht. Besser wird es erst, wenn meine freundliche Ohrenärztin den Pfropf entfernt. Und so steht künftig alle zwei bis drei Monate ein Besuch bei ihr in meinem Kalender.