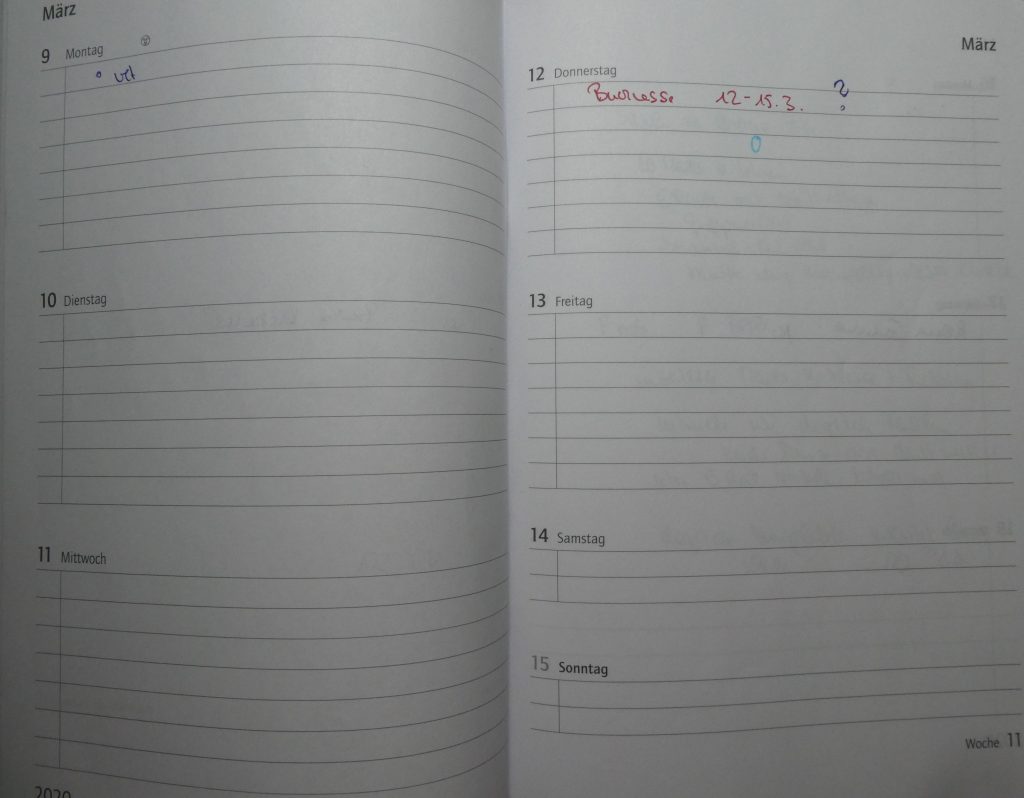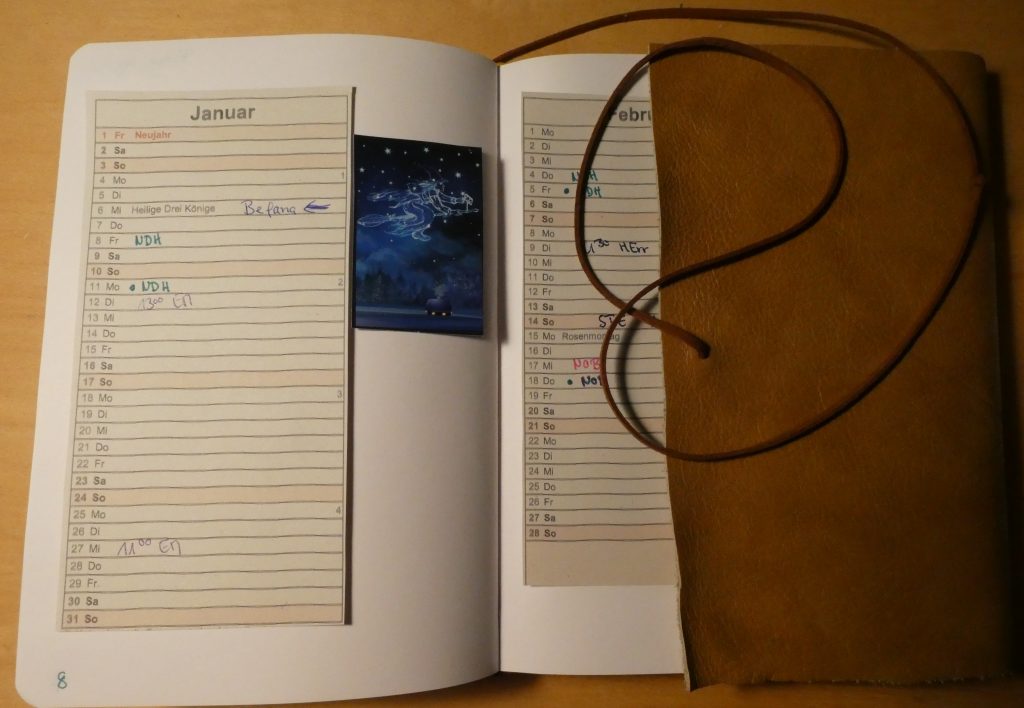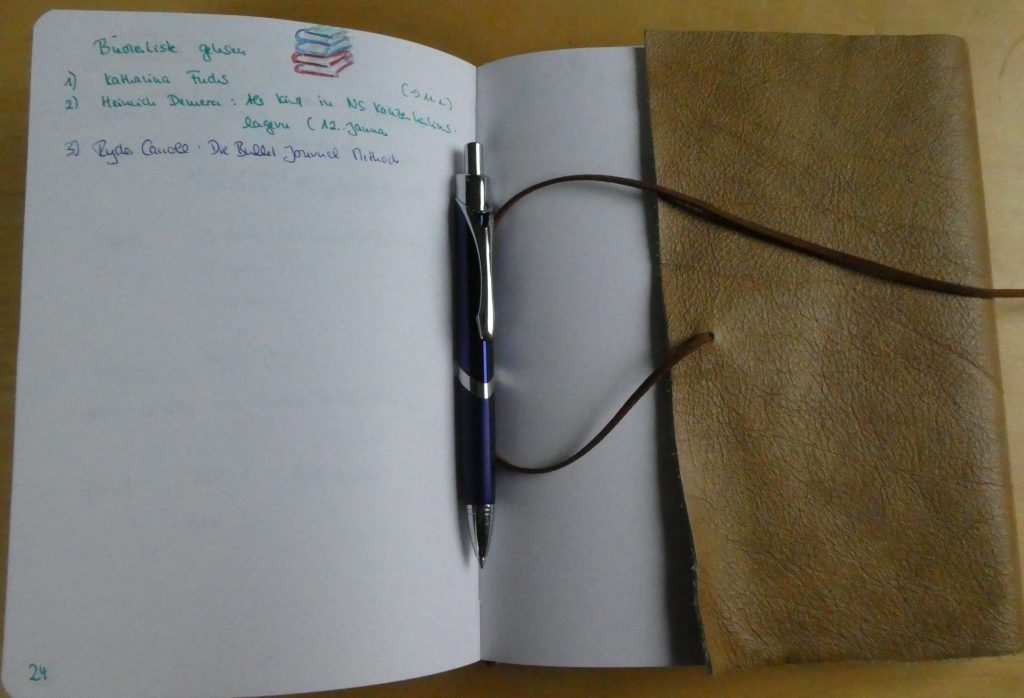Ja, ich bin abergläubisch, zumindest ein bisschen. Ich lese zum Beispiel manchmal Horoskope und lege gelegentlich Tarotkarten – allerdings ohne mich wirklich danach zu richten. Die Raunächte „zwischen den Jahren“ sind für mich eine besondere Zeit, und davon, dass es Kräfte und Dinge gibt, die Naturwissenschaften und Naturgesetze nicht erklären, bin ich überzeugt. Daran, dass Schornsteinfeger Glück oder schwarze Katzen Unglück bringen, glaube ich indes nicht. Im Gegenteil: Kiara ist der lebende Beweis, dass schwarze Katzen sehr glücklich machen können. Aber das ist ein anderes Thema – zurück zum Aberglauben:



„Aberglaube, seltener Aberglauben, der“ ist laut Duden.de ein„als irrig angesehener Glaube an die Wirksamkeit übernatürlicher Kräfte bei bestimmten Menschen und Dingen“. Welcher Glaube aber irrig, falsch oder schlecht und welcher richtig ist, hängt vom weltanschaulichen oder religiösen Standpunkt des Betrachters oder der Betrachterin bzw. der Bestimmenden ab. Hierzulande bestimmten lange die christlichen Kirchen, vor allem die katholische, was Aberglaube ist – das waren im Prinzip alle „religiösen Vorstellungen, die von der christlichen Lehre abweichen und in denen Reste vorchristlichen Denkens oder magischer Vorstellungen vermutet wurden“(https://www.wissen.de/lexikon/aberglaube).
Was von der christlichen Glaubenslehre abwich, galt als heidnisch, unmoralisch, ketzerisch und wurde bekämpft und vernichtet. Das hinderte die Kirche aber nicht daran, sich eifrig im Fundus der vorchristlichen Religionen zu bedienen. Weihnachten, das Fest der Geburt Jesu Christi, ist wohl das bekannteste Beispiel. Zur Zeit der Wintersonnenwende lange vor Christi Geburt in vielen Kulturen Feste gefeiert: im Alten Ägypten zu Ehren von Isis und Osiris, in China Dong Zhi, das Ankommen des Winters, im römischen Reich sol invictus. Und lange bevor die Christen Ostern zum Fest der Auferstehung ihres Religionsstifters umfunktionierten, feierten Kelten und Germanen – und nicht nur sie – Ende März die Tag- und Nachtgleiche.
Auch Lichtmess, das christliche Fest am 2. Februar, haben nicht die Christen erfunden, sondern die Kelten. Sie feierten am zweiten Vollmond nach der Wintersonnenwende, also um den 1. Februar herum, wenn die Tage wieder länger werden, ein Fest des Lichts und der Hoffnung: Imbolc oder Oimelc. Um Unheil fernzuhalten, wurden in der Nacht um den 1. Februar Kerzen angezündet. Die Druiden, die keltischen Priester, führten Reinigungsrituale durch und sprachen schützende Zauber aus.
Aberglaube, (ver)urteilte die Kirche und ersetzte die heidnischen Heil- und Schutzzauber durch eigene, die aber nicht mehr Zauber, sondern Segen hießen. So spenden katholische Priester zum Beispiel an Lichtmess oder am 3. Februar, dem Namenstag des Heiligen Blasius, einen nach ihm benannten Segen. Der Blasiussegen soll durch die Fürsprache des Bischofs und Märtyrers die Gläubigen „von allem Übel des Halses und jedem anderen Übel“ befreien und bewahren. Oder muss es heißen die Abergläubischen? Denn das Segensritual mit gekreuzten Kerzen entspricht der Definition von Aberglauben ziemlich genau: Es sind „Praktiken und Riten, die ausgeübt werden, um bestimmte magische Wirkungen herbeizuführen oder unerwünschte abzuwehren“ (https://www.wissen.de/lexikon/aberglaube).
Ich bin katholisch geboren, katholische Riten und Praktiken haben mich in meiner Kindheit geprägt. Den letzten Blasiussegen habe ich wohl vor rund einem halben Jahrhundert bekommen – trotzdem ist er in meinem Gedächtnis geblieben. Als Kind hat mich vor allem beeindruckt und beschäftigt, dass der Segen verhindern sollte, dass ich an einer Fischgräte ersticke – obwohl oder vielleicht auch gerade weil es bei uns zu Hause nie Fisch gab. Wozu brauchte ich also diesen Segen?
Immerhin: Halsschmerzen habe ich nur selten und auch eine größere Fischgräte habe ich noch nie verschluckt. Doch das liegt, davon bin ich überzeugt, eher an meiner robusten Gesundheit und an meiner Vorsicht bei Fischgerichten als an der Langzeitwirkung des Segens. Aber wenn er auch nichts genutzt hat, hat er wohl auch nicht geschadet. Und so werde ich weiter meinen kleinen abergläubischen Gewohnheiten frönen. Denn mit dem Glauben oder dem Aberglauben ist es ja ohnehin so eine Sache …