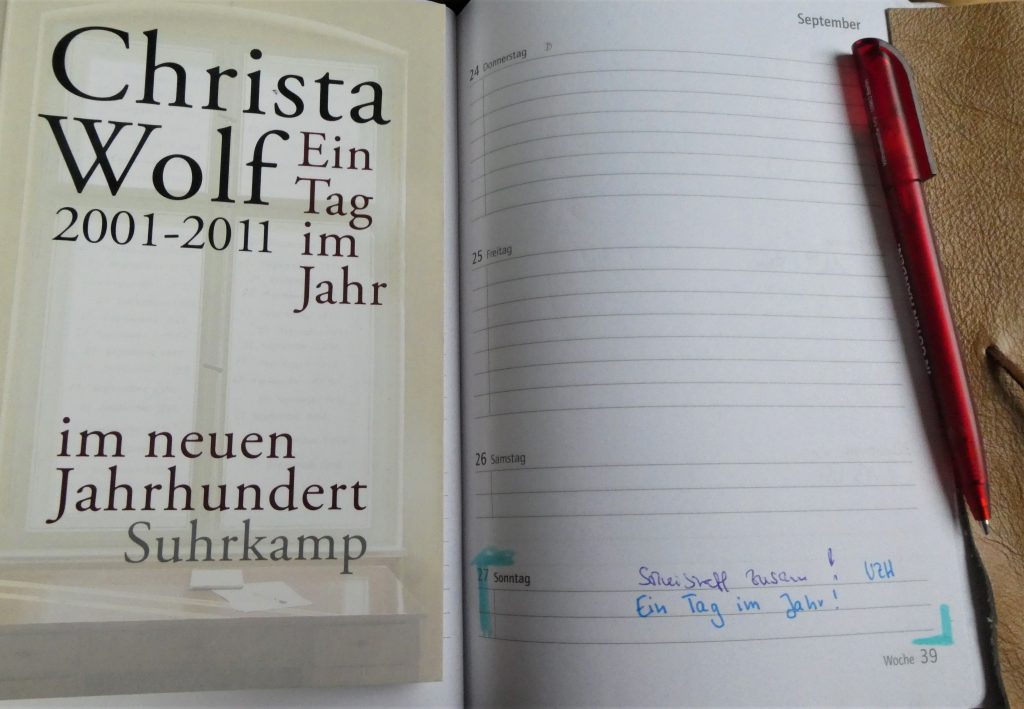Es ist an der Zeit, die Lanze für ein Sternzeichen zu brechen, das auf der Liste der unbeliebten Sternzeichen ganz oben steht: für Skorpione. Glaubt man einer Statistik – was man ja bekanntlich nur tun soll, wenn man sie selbst gefälscht hat –, begehen Menschen, die in diesem Sternzeichen geboren sind, fast die meisten Verbrechen. Nur Krebse haben angeblich noch mehr kriminelle Energie. Und auch in Sagen und Mythen werden Skorpione meist als gefährliche, todbringende Wesen dargestellt. Zu Unrecht, wie ich meine.
Die Liste der negativen Eigenschaften, die Skorpionen zugeschrieben werden, ist lang: Skorpione gelten beispielsweise als eifersüchtig, kompromisslos, misstrauisch, nachtragend, pessimistisch, rachsüchtig, skrupellos, undurchschaubar und verbissen. Dass sie analysierend, ausdauernd, belastbar, engagiert, grübelnd, intelligent, kreativ, leidenschaftlich, selbstkritisch, zäh, zielstrebig und zuverlässig sein sollen, spricht eigentlich für sie. Doch wer vieles hinterfragt und Dingen auf den Grund geht, wie es für Skorpione charakteristisch sein soll, sammelt in der Zeit der Fake News und der alternativen Fakten, der Trumps, Johnsons und Erdogans, der Covidioten und der angeblichen Querdenker wenig Sympathiepunkte.
Und dann ist da natürlich der Stachel, der vielen Angst macht. Dabei könnte ein Blick ins Tierreich helfen. Denn Skorpione setzen ihren Stachel meist zur Verteidigung ein, seltener um Beute zu machen. Der Stich der meisten Skorpione ist für Menschen ungefährlich – die Symptome sind oft eher vergleichbar mit einem Bienenstich. Nur das Gift weniger Arten kann auch für Menschen tödlich sein – wenn sie nicht behandelt werden. Kein Grund zur Panik also – auch wenn ich zugeben muss, dass ich kein Fan der Spinnentiere bin.
Skorpion-Menschen mag ich dagegen meist, wohl auch, weil ich selbst einer bin. Meine beste Freundin ist Skorpion, der beste „Chef“, mit dem ich je zusammengearbeitet habe, und die kompetenteste und freundlichste Kassiererin hier im Ort ebenfalls. Ich kenne keinen Skorpion persönlich, der mir wirklich unsympathisch ist. Im Gegenteil: Wenn ich Leute nett finde, stellt sich im Nachhinein nicht selten heraus, dass sie Ende Oktober oder im November geboren sind – der ähnliche Geburtstermin verbindet, allen Unterschieden zum Trotz.
Als ich nach dem Studium wieder eine Zeitlang an der Mosel lebte, habe ich zwei Skorpionfeste gefeiert. Die Eingeladenen hatten nur zwei Dinge gemeinsam: Sie waren Skorpione und sie kannten mich. Der Älteste war fast 60, die Jüngste gerade mal 11. Vor dem ersten Fest waren die Gäste skeptisch – vor allem, weil die meisten sich nicht oder nur flüchtig kannten und nicht wussten, was sie erwartete.
Trotzdem kamen alle, die ich eingeladen hatte – und alle verstanden und unterhielten sich prächtig. Der einzige Mann in der Runde, der Mann einer Freundin, verriet mir später, dass er eigentlich nur gekommen sei, weil er nicht unhöflich sein wollte, und dass er fest vorhatte, schnell wieder zu verschwinden. Doch dann blieb er wie alle anderen bis weit nach Mitternacht. Und alle kamen im nächsten Jahr wieder, weil das erste Fest ihnen gut gefallen hatte. Dann bin ich umgezogen und die Skorpionfeste hörten auf.
Schade, meinte eine Teilnehmerin, die ich zufällig fast 30 Jahre später beim Spazierengehen an der Mosel wiedertraf. Sie denke noch oft an die beiden Feste, sagte sie. Sie habe sich selten so gut unterhalten. Und einige Skorpione, die ich später kennenlernte, bedauerten, dass sie nicht dabei waren.
Vielleicht lasse ich die alte Tradition wieder aufleben. Nach Corona. Und im Jahr eins nach Donald Trump.
Übrigens: Trumps Nachfolger Joe Biden ist Skorpion.
Und Happy Birthday Sabine. Herzliche Grüße von Skorpionin zu Skorpionin