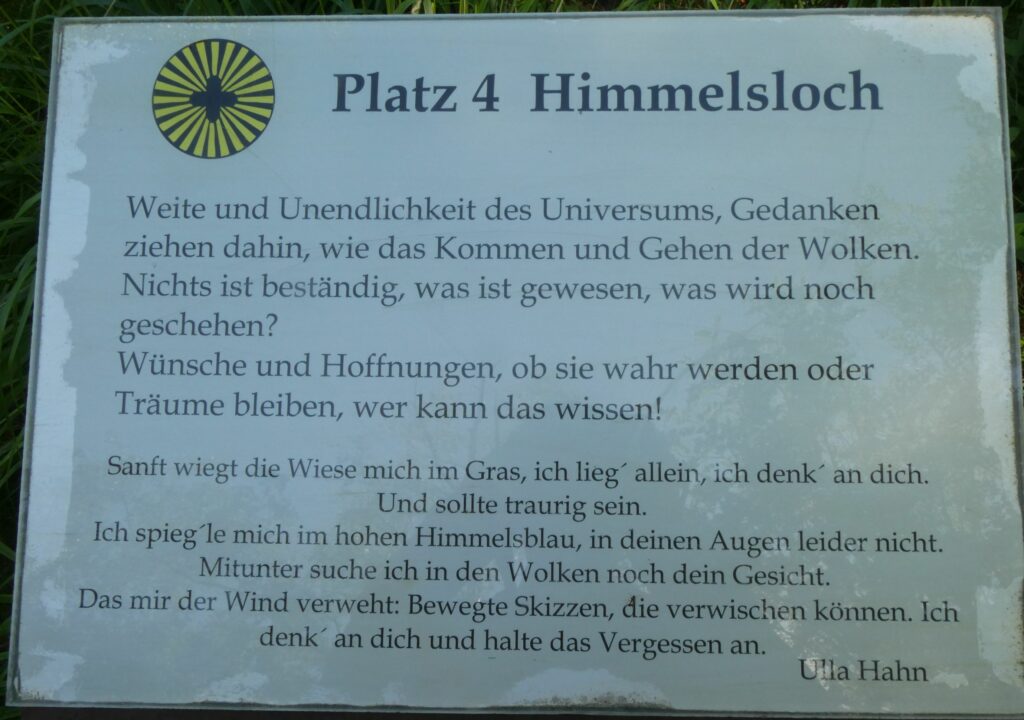Manchmal muss es eben Meer sein. Im Juni war es die Nordsee, denn sie ist, wenn man in der Nähe von Hannover lebt, am schnellsten zu erreichen. Wenn alles gut geht, dauert die Fahrt nach Cuxhaven knapp zwei Stunden. Und man erspart sich die Staus um Hamburg, in die man fast immer gerät, wenn man an die Ostsee fährt.
Leider ist die Nordsee meist gerade nicht da, wenn man kommt. Aber immerhin kann man sich darauf verlassen, dass das Wasser immer wiederkommt: Pünktlich nach dem Gezeitenkalender folgt auf jede Ebbe eine Flut. Und das Wattenmeer, das sich von der niederländischen Insel Texel bis zum dänischen Esbjerg erstreckt, ist wirklich etwas Besonderes. Mehr als 10.000 Tier- und Pflanzenarten sollen in der vom Wechsel der Gezeiten geprägten Naturraum leben, außerdem machen im Frühjahr und Herbst jährlich zehn Millionen Zugvögel auf ihrer Reise in den Süden bzw. in den Norden hier Station (https://www.nabu.de/natur-und-landschaft/meere/wattenmeer/index.html). Damit dieser einzigartige Lebensraum erhalten bleibt, steht er als Weltnaturerbe unter besonderem Schutz.
Meist fahren wir nach Döse bei Cuxhaven, doch diesmal haben wir zuerst einen Abstecher nach Otterndorf gemacht und dort eine Nacht auf einem kleinen Stellplatz an der Medem-Schleuse verbracht.
Wir sind an der Elbe entlangspaziert, auf der die riesigen Containerschiffe Richtung Hamburg oder hinaus auf die Nordsee schippern. In der Otterndorfer Altstadt haben mir die Häuser, die direkt an der Medem liegen, besonders gut gefallen. Sie erinnern mich ein bisschen an Amsterdam oder Venedig – zwei Orte, die schon lange auf meiner To-Visit-Liste stehen. Einige Häuser in der Altstadt stammen aus dem 16. Jahrhundert, noch älter ist die St.-Severi-Kirche, die schon im 12. Jahrhundert gebaut und später oft umgebaut wurde. Hinter den eher nüchternen typisch norddeutschen Backsteinmauern verbirgt sich eine prächtige Innenausstattung aus dem 16. und 17. Jahrhundert.



„Die Bänke und Stühle wurden von den Pfarrmitgliedern erworben“, lese ich in einer von Marie-Luise Grefe verfassten Beschreibung der Kunstschätze der Kirche (https://kirche-otterndorf.de/wp-content/uploads/2024/05/24-Otterndorfer-Kirche-neu-mit-Bildern-X.-von-Marie-Luise-Grefe.pdf). Die Plätze wurden von Juraten, den gewählten oder bestellten Vertreter der Kirchengemeinde, vergeben. „Sie konnten vererbt oder mit Zustimmung des Juraten weiter verkauft werden.“ Bei Besitzerwechsel wurde noch Anfang des 20. Jahrhunderts eine Umschreibegebühr fällig.
Die Besitzer konnten ihre Bänke nach Gutdünken bemalen, gestalten und mit ihren Namen versehen. Erst 1935 wurden die Namen übermalt und sind seitdem für alle zugänglich. Doch heute bleiben die Kirchenbänke wahrscheinlich auch in Otterndorf wie auch andernorts meist leer. So ändern sich die Zeiten.
Keine Frage, der kleine Ort an der Elbe ist eine Reise wert. Und wir werden gewiss wiederkommen, dann aber mit Fahrrad und Kanu, um den Ort und die Gegend besser – auch vom Wasser aus – zu erkunden. Am zweiten Tag hat unseres Kurzurlaubs hat es uns dann doch wieder direkt ans Meer gezogen – auf „unseren“ Stellplatz direkt an der Kugelbake.
Seine Bedeutung als Orientierungshilfe für die Seefahrer hat das bei TouristInnen beliebte Seezeichen aus Holz längst verloren. Und wenn die riesigen Containerschiffe vorbeiziehen, frage ich mich, ob die Steuerleute von hoch oben die nur knapp 30 Meter hohe Bake überhaupt noch wahrnehmen.
Der Stellplatz, der eigentlich nur ein Parkplatz ist, liegt direkt hinterm Deich. Wir müssen nur eine Treppe hochgehen, um zum Strand zu kommen, der sich kilometerweit über Duhnen bis nach Sahlenburg erstreckt.



Geschwommen bin ich hier noch nie. Denn man muss auch bei Flut gefühlt kilometerweit hinauslaufen, bis das Wasser tief genug dazu ist. Aber ich liebe es, barfuß über den Sand und durch das Watt zu waten. Und oft sitze ich einfach nur da, lese, schreibe und genieße den Blick aufs Wasser, wenn es denn da ist, oder aufs Watt. Wenn das Wetter mitspielt, kann ich morgens die Sonne im Osten über dem Meer auf- und abends im Westen überm Meer untergehen sehen. Was will frau mehr – vielleicht den direkten Blick vom Stellplatz aufs Wasser.
Den gibt es angeblich ein paar Kilometer weiter, erzählt eine Stellplatznachbarin. Der Stellplatz in Harlesiel liege vor dem Deich, der den Blick aufs Wasser verdeckt. Toiletten und Duschen gebe es direkt auf dem Platz, außerdem ein Schwimmbad mit Meerwasser. Das klang so vielversprechend, dass wir uns das selbst ansehen wollten. Doch dann wären wir zwei Wochen später fast auf dem falschen Stellplatz gelandet.
Bei Harle und Siel kam mir nämlich als Erstes Neuharlingersiel in den Sinn – der Ort, an dem ich vor 50 Jahren zum ersten Mal am Meer war, mit einer Trainingsgruppe des SV Wintrich (danke an Edi, meinen früheren Trainer, nicht nur für das Trainingslager). Doch der Stellplatz in Neuharlingersiel war, das merkte ich bei der Recherche im Internet, nicht der richtige: Er liegt zwar auch am Anleger, die Toiletten können aber nur tagsüber während der Öffnungszeiten der Tourist-Information benutzt werden. Für mich ist das ein K.o.-Kriterium. Auf dem Campingplatz funktionierte die Online-Buchung von drei Computern, mit denen wir es versuchen, nicht. Und für eine telefonische Buchung oder eine Buchung an der Rezeption sollten wir zehn Euro extra zahlen. Für mich ein Unding. Also suchte ich weiter und fand schließlich den Wohnmobilstellplatz in Harlesiel. Der liegt, wie von der Stellplatznachbarin in Döse angekündigt, direkt an der Mole, mit Blick aufs Wasser. Reservierungen sind nicht möglich, doch als wir mittags ankamen, waren noch ein paar Plätze frei. Und unsere Stellfläche war großgenug für unser kleines Wohnmobil und das Auto unserer Tochter. Die kam erst abends nach der Arbeit, als alle Plätze längst belegt waren.
Nele interessiert sich seit ihrer Kindheit für Vögel und wenn ich mit ihr unterwegs bin, egal ob beim Wandern im Harz oder beim Kurzurlaub am Meer, sehe ich Vögel, die ich bis dahin gar nicht kannte. Diesmal zum Beispiel einen Löffler, der aussieht wie ein Storch, allerdings einen löffelartigen Schnabel hat. Mit dem sucht er im Watt nach Nahrung – ein bisschen sieht es so aus, als würde er den Boden mit einem Staubsauger bearbeiten (Neles Vogel- und viele andere Fotos sind auf Ihrer Webseite https://foerodens.wordpress.com/ zu sehen).


Harlesiel selbst und der Nachbarort Carolinensiel liegen hinter dem schützenden Deich an der Harle, einem kleinen, gerade mal 23 Kilometer langen Flüsschen, das durch ein sogenanntes Siel ins Meer mündet. Siele, die hier in Ostfriesland vielen Orten ihren Namen geben, sind kaut Wikipedia verschließbare Gewässerdurchlasse in Deichen und fungieren quasi als Ventile. Durch sie fließt das Wasser aus Flüssen und Entwässerungsgräben ins Meer ab, sie lassen aber kein Meerwasser ins Binnenland. „Tideabhängig erfolgt das Schließen normalerweise durch höheren Druck bei höherem Wasserstand auf der Meerseite, das Öffnen dagegen durch höheren Druck von der Binnenseite bei niedrigerem Wasserstand auf der Meerseite“, lese ich bei Wikipedia. Dort erfahre ich auch, dass das Wort Siel wahrscheinlich aus dem Friesischen stammt, auf das Verb „seihen“ zurückgeht und eine „Stelle, wo Wasser ausfließen kann“ bezeichnet (https://de.wikipedia.org/wiki/Siel). Wieder was gelernt.
Sonnenuntergänge am Meer haben wir in Harlesiel auch erlebt – und wir waren nicht die einzigen, die dieses Naturschauspiel fasziniert beobachteten. An einem Abend bot die Natur sogar ein doppeltes Schauspiel. Im Westen versank die Sonne im Meer während sich im Osten ein Regenbogen über das Land spannte.



Last but not least habe ich in Harlesiel (wieder) gemerkt, dass es mir gut tut zu schwimmen – und dass es eigentlich sogar Spaß macht, wenn ich meinen inneren Schweinehund und die Scheu vor dem Wasser überwinde, dass meist gar nicht so kalt ist, wie ich befürchte. Da das Schwimmbad direkt vor der Stellplatztür lag und die Nutzung in der Stellplatzgebühr enthalten war, sind meine Tochter und ich jeden Tag ein paar Runden geschwommen. Das will ich auch in Burgwedel fortsetzen.