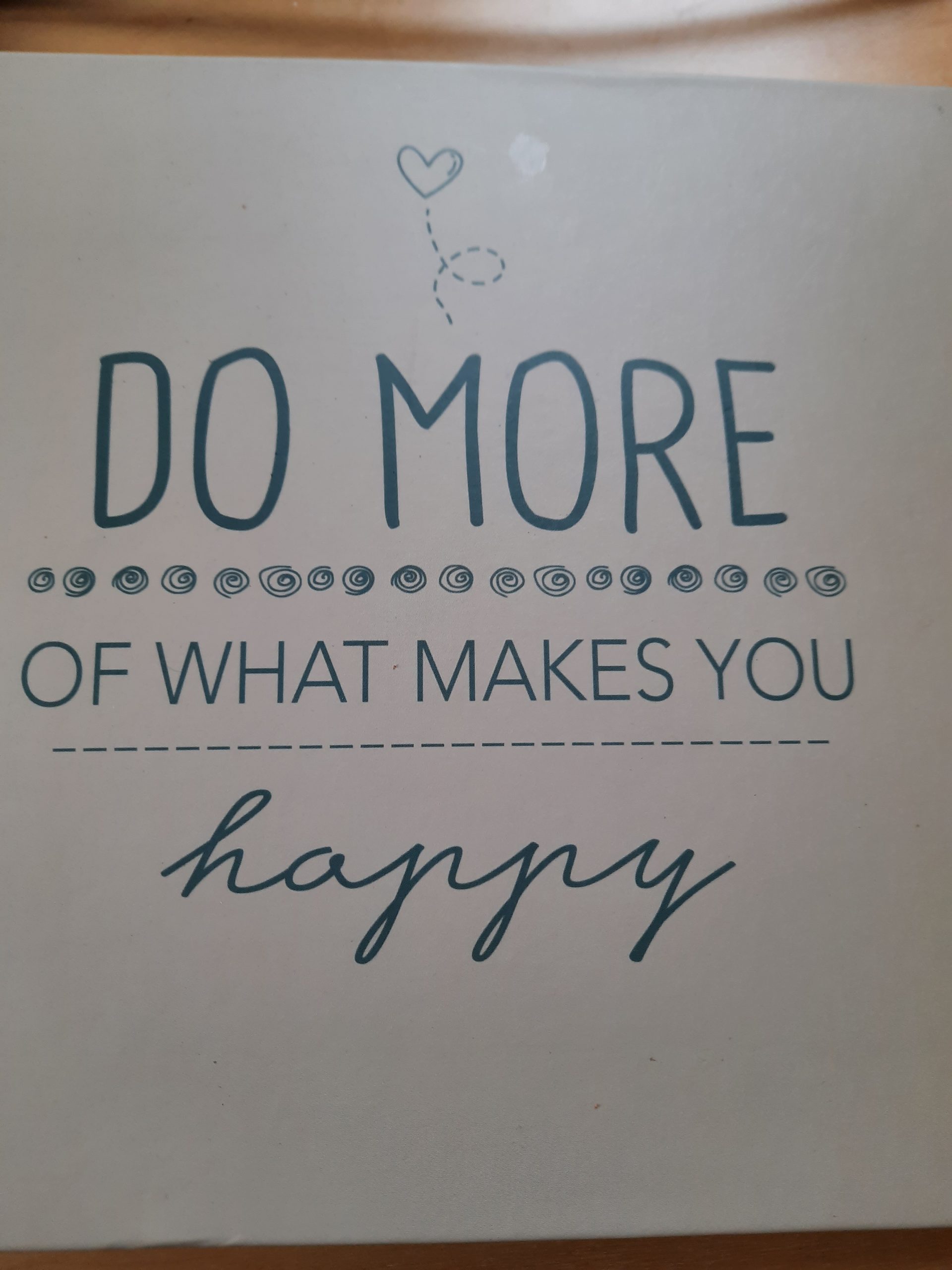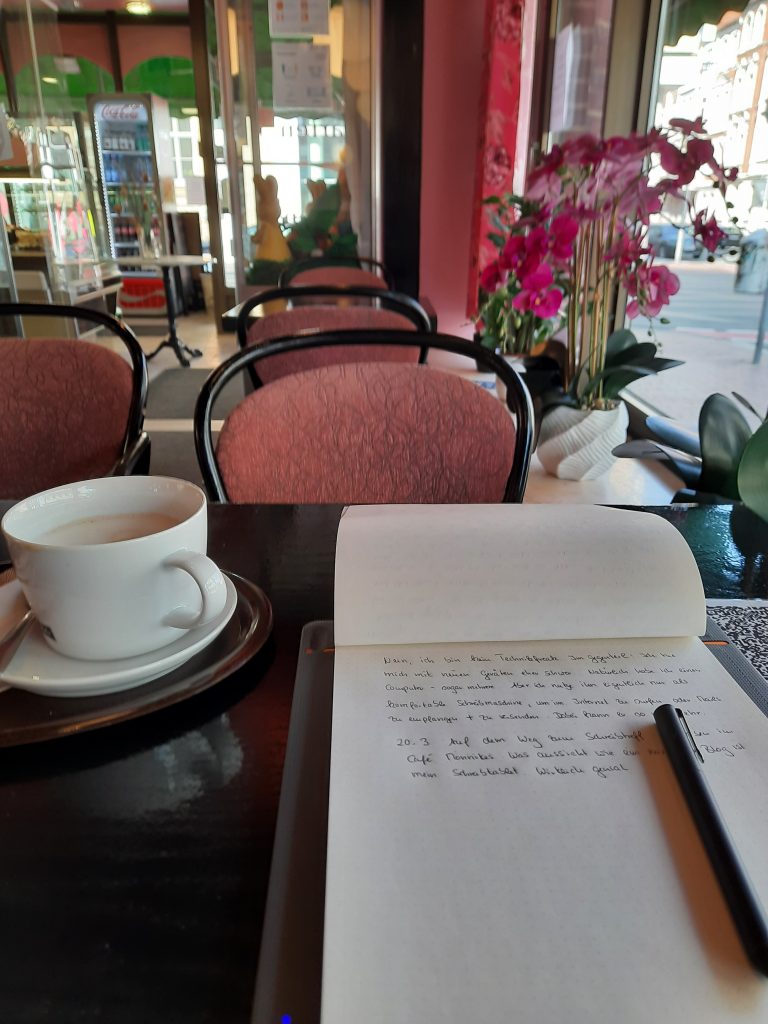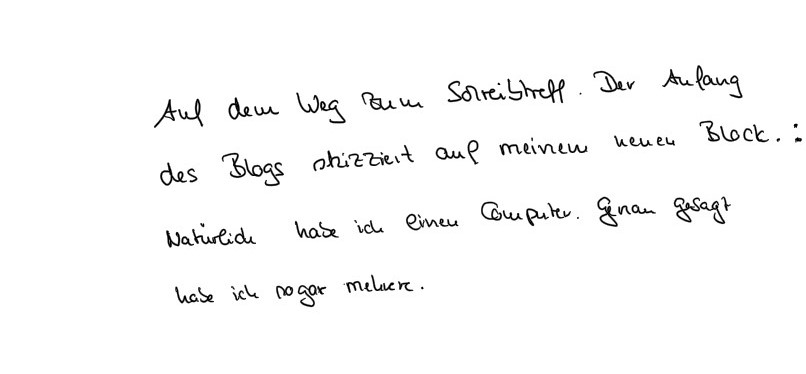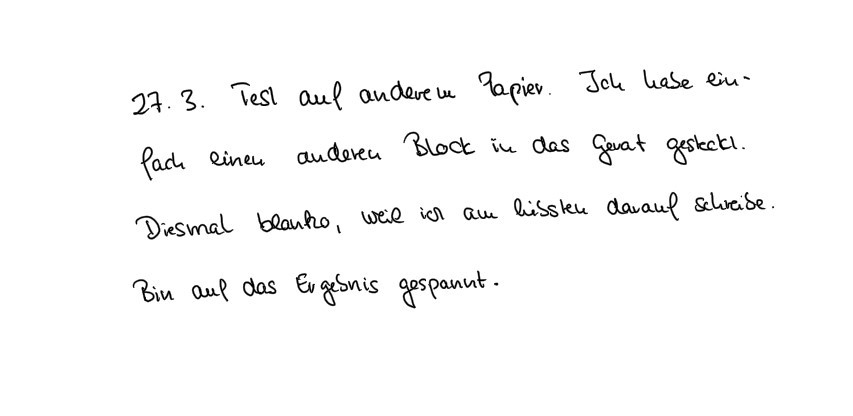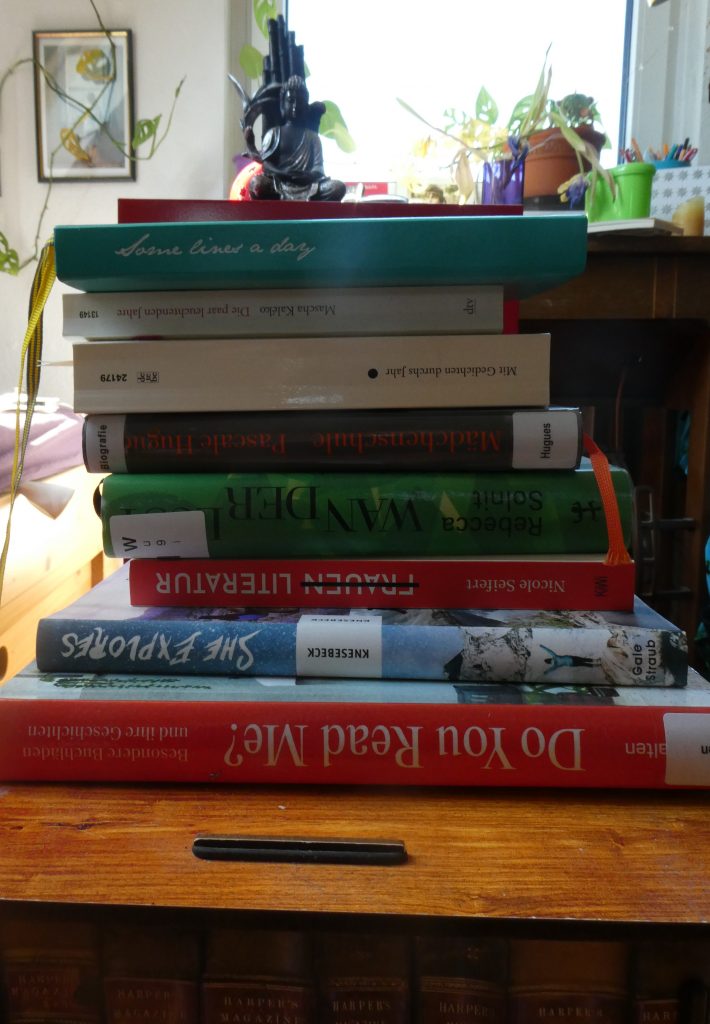Als der Schweizer Schriftsteller und Kabarettist Franz Hohler 60 Jahre alt wurde, nahm er sich vor, ein Jahr lang keine Auftritte und Lesungen, dafür aber jede Woche eine Wanderung zu machen. Denn beim Gehen fühlt er sich „gut und frei“, wie er in seinem Buch „52 Wanderungen“ schreibt. Außerdem wollte er in diesem Jahr auch „für das Alter üben“.
Nun liegt mein eigener 60. Geburtstag schon ziemlich lange zurück; im Oktober gehe ich in Rente. Viel Zeit zu üben bleibt also nicht mehr. Zudem habe ich in den nächsten drei Monaten wenig Freizeit, weil ich auch in diesem Sommer wieder – noch einmal – eine Zeitschrift betreue. Das bedeutet viel recherchieren, viel schreiben, viel Arbeit.
Trotzdem reizt mich die Idee – und die Gelegenheit ist günstig. Mit dem 9-Euro-Ticket kann ich in den nächsten drei Monaten kreuz und quer durchs Land reisen – und das will ich nutzen. Ich habe mir deshalb vorgenommen, in den nächsten drei Monaten jede Woche zumindest einen Ausflug zu machen – zu Fuß, mit dem Fahrrad, mit Öffis oder mit dem Wohnmobil. Und natürlich will ich im Blog – hoffentlich jede Woche – darüber schreiben.



Das erste Ziel am Pfingstsonntag: Celle. Nach Celle fahre ich eher selten. Dabei liegt das Städtchen mit dem Zug nur eine Station und zehn Minuten entfernt – und ist mit mehr als 400 alten, meist gut restaurierten Fachwerk-, Barock und Jugendstilhäusern wirklich hübsch. Die Aller fließt mitten durch die Stadt, das barocke Schloss ist vom Schloßgraben umgeben, die Altstadt vom Stadtgraben und der Französische Garten, ein Park am Rande der Altstadt, wird vom Magnusgraben begrenzt.



Gestern lockte mich zudem die Allerart, ein Kunsthandwerker- und Antiquitätenmarkt rund ums Schloss, außerdem wollte ich mir den barocken Rosengarten im Französischen Garten ansehen. Beides war, ich gebe es zu, eher enttäuschend. Das Allervergnügen war eher ein Flohmarkt mit Eintritt, der Rosengarten eher ein Gärtchen, in dem es nicht allzu viele Rosen gab. Dafür ein Denkmal für Ernst Schulze, einen in Celle geborenen und aufgewachsenen Dichter der Romantik. Ich gebe zu, ich kannte nicht einmal seinen Namen und habe noch nie etwas von ihm gelesen – Letzteres wird wohl auch so bleiben. Weder „Caecilie“, ein romantisches Gedicht in zwanzig Gesängen und zwei Bänden, noch die „Reise durch das Weserthal“ werden es je auf meine Must-read-Liste schaffen.

Gelohnt hat sich der Ausflug trotzdem – schon wegen der Lindenallee im Französischen Garten und den dunkel lila blühenden Rhododendronbüschen. Und die alte Weide, die in den kreisrunden Teich im Französischen Garten hineinwächst, ist ebenfalls sehenswert.



Sehr gut gefallen hat mir auch das Kunstprojekt „zuKUNSTperspektiven“: Noch bis zum 2. Juli zeigen SchülerInnen aus Celle und Umgebung an vier verschiedenen Orten ihre Kunstwerke – und was sie bewegt, welche Träume, Vorstellungen, Wünsche und Ängste sie haben. Grund genug, wiederzukommen und mir auch die Bilder in den anderen Ausstellungsorten anzusehen. Mehr Infos über das in Zusammenarbeit mit Lehrkräften verschiedener Schulen entstandene Projekt des Vereins KulturTrif(f)t e.V. unter https://kulturtrifft.de/zukunst-perspektiven/.