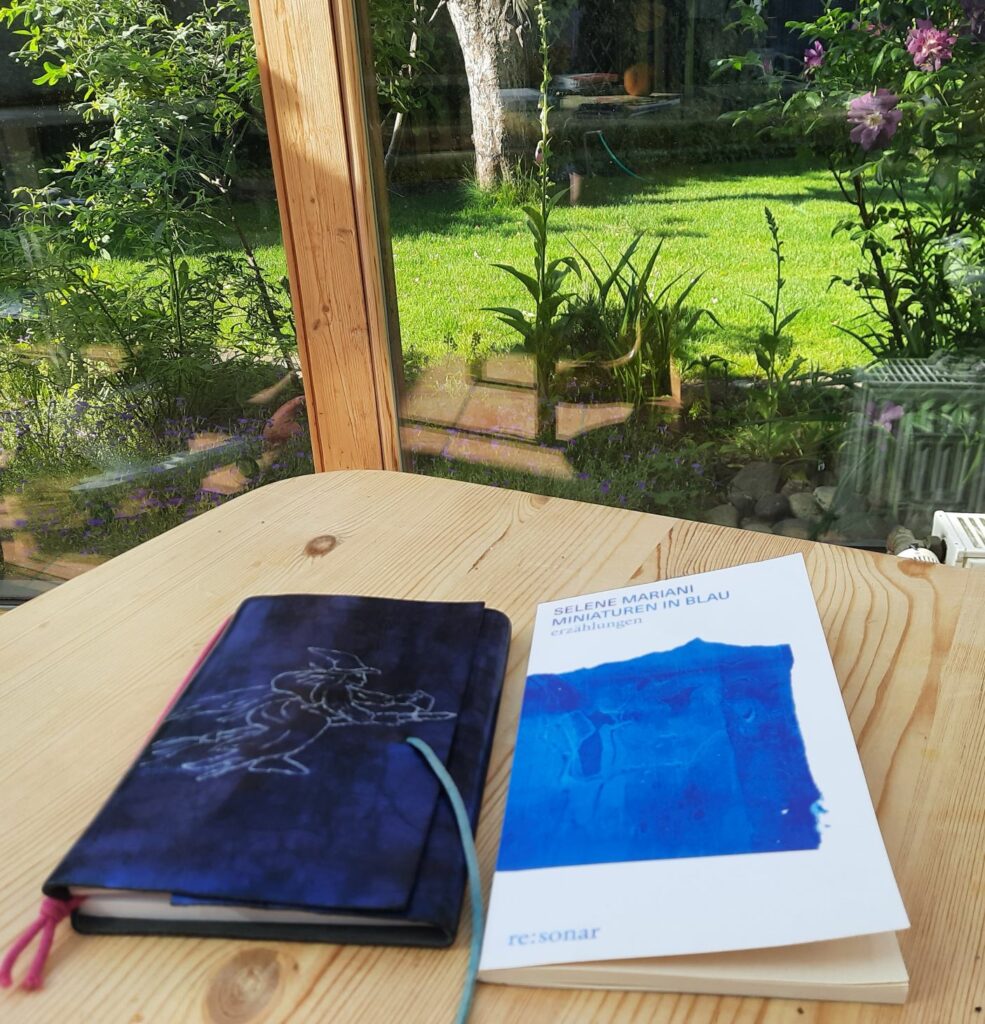Zugegeben, mit Eschede habe ich bislang nur Negatives verbunden. Da war natürlich das Zug-Unglück am 3. Juni 1998: Als der ICE 884 „Wilhelm Conrad Röntgen“ wegen eines defekten Reifens entgleiste, starben 101 Menschen, 105 wurden verletzt, viele von ihnen schwer (https://de.wikipedia.org/wiki/Eisenbahnunfall_von_Eschede). Und da sind natürlich die Rechtsextremen, die sich seit Jahrzehnten regelmäßig auf einem ehemaligen Bauernhof bei Eschede treffen.
Ich fahre immer durch den Ort, wenn ich mit dem Zug gen Norden fahre; ausgestiegen bin ich allerdings bislang erst einmal: im vergangenen Herbst, um an einer Demonstration gegen jenen Nazi-Treffpunkt teilzunehmen. Es war ein ziemlich beängstigendes Gefühl, an dem Hof vorbeizugehen, wo vermummte Männer uns filmten. Dass einige TeilnehmerInnen an der Demonstration ihre Gesichter ebenfalls versteckten, um nicht erkannt zu werden, konnte ich gut verstehen. Und ich war froh, dass so viele PolizistInnen uns begleiteten, wohl mehr, um uns als den Hof zu schützen.„Wohnen“, dachte ich damals, „möchte ich Eschede nicht.“
Dass ich Eschede seit Sonntag auch mit Schönem verbinde, ist eher Zufall. Weil die an diesem Wochenende offenen Gärten in der Region Hannover mit Öffentlichen Verkehrsmitteln nur schwer zu erreichen waren, suchte ich am Samstagabend nach besser erreichbaren Alternativen – und fand vier Gartenpforten in Eschede, die von Nabu-Mitgliedern geöffnet wurden.
Nicht einmal 20 Minuten dauerte die Zugfahrt von Burgwedel in den Heideort – und allein wegen des ersten Gartens hat sie sich gelohnt. „Hier könnte ich bleiben“, war mein erster Gedanke, als ich durch die offene Pforte trat. Der 3.000 m² große Garten von Helga und Guido Schuller ist wirklich ein Traum – mitvielen, zum Teil alten Bäumen und Sträuchern, ganz unterschiedlichen Stauden-, Obst- und Gemüsebeeten. Es gibt eine Sammlung von alten Fuchsienhochstämmen, ein Gewächshaus mit einer Kakteensammlung, zahlreiche Nistkästen und natürlich verwilderte Ecken mit Totholzhaufen.



Besonders gut gefallen haben mir die Teiche: Der neuere mit großer Flachwasserzone liegt – sonnenbeschienen – im vorderen Bereich des Gartens, ein zweiter versteckt sich im hinteren Bereich unter Bäumen. In die kleine, von Rosen umramkte Hütte am Rand des Teichs wäre ich gerne eingezogen. Aber auch das Gewächshaus direkt neben dem Seerosenteich lud zum Schreiben und zum Bleiben ein. Und weil die GartenbesitzerInnen bei der Auswahl der Pflanzen viel Wert auf die Insektenfreundlichkeit legen, fühlen sich im Garten nicht nur menschliche BesucherInnen wohl.



Nach dem furiosen Auftakt waren meine Erwartungen natürlich hoch, und die anderen beiden Gärten enttäuschten sie nicht. Als „Kompromiss zwischen einem gestalteten, kulturell geprägten Garten und einer Wildnis“ versteht Christine Lange-Krüger ihren Garten. „Eingriffe erfolgen nur, um die Pflanzenvielfalt zu erhalten und Gräser im Zaum zu halten.“ Wildstauden, vogelfreundliche Gehölze, ein kleiner Teich und eine kleine Obstwiese bieten viel Nahrung und Raum für Insekten und Vögel. Mein Lieblingsplatz war die mit echtem und wildem Wein bewachsene Pergola. Oder vielleicht doch die hinterm Rosenbogen versteckte Bank?



Dass der Garten von Johanna Schuller noch im Umbruch ist, sieht man ihm nicht an. „Auf einer ehemaligen Wiese mit verschiedenen heimischen oder auch exotischen Büschen am Rand, entsteht nach und nach eine bunte Mischung aus Nutz- und Naturgarten“, beschreibt sie ihn in der Broschüre, die im Internet unter www.offene-Pforte-celle.de heruntergeladen werden kann. Mit gefiel der Garten mit Gemüse- und Staudenbeeten, Kräuterinseln, Gewächshaus, Wildblumenwiese und wilden Ecken schon jetzt. Selbst ein Teich fehlt nicht.



Den Weg zum vierten Garten, der seine Pforte geöffnet hat, sparte ich mir – nicht, weil mich der artenreiche (Wild)Staudengarten mit Streuobstwiese nicht interessierte. Aber er liegt in Habighorst, etwa zwei Kilometer von Eschede entfernt. Zu Fuß hätte ich für Hin-, Rückweg und Gartenbesichtigung mindestens eine Stunde gebraucht – und die dunklen Wolken am Himmel verhießen nichts Gutes. Einen Schirm habe ich nicht dabei und die Regenjacke in meinem Rucksack hätte einem Platzregen, wie ich ihn am Vortag erlebt hatte, kaum standgehalten.
Und weil aller guten Dinge ja bekanntlich drei sind, .ging ich zurück zum Bahnhof und fuhr nach Hause. Aber ich werde sicher wieder einmal in den kleinen Heideort kommen, den ich künftig nicht nur mit Zugunglücken und Rechtsradikalen verbinde, sondern auch mit wunderschönen Gärten.