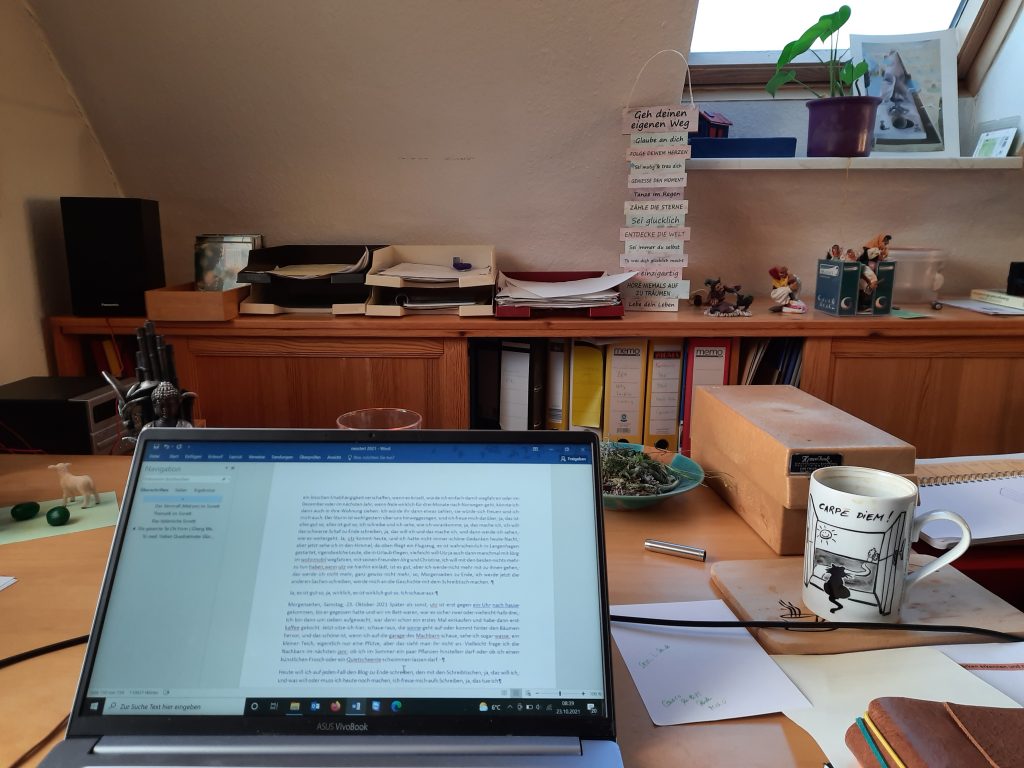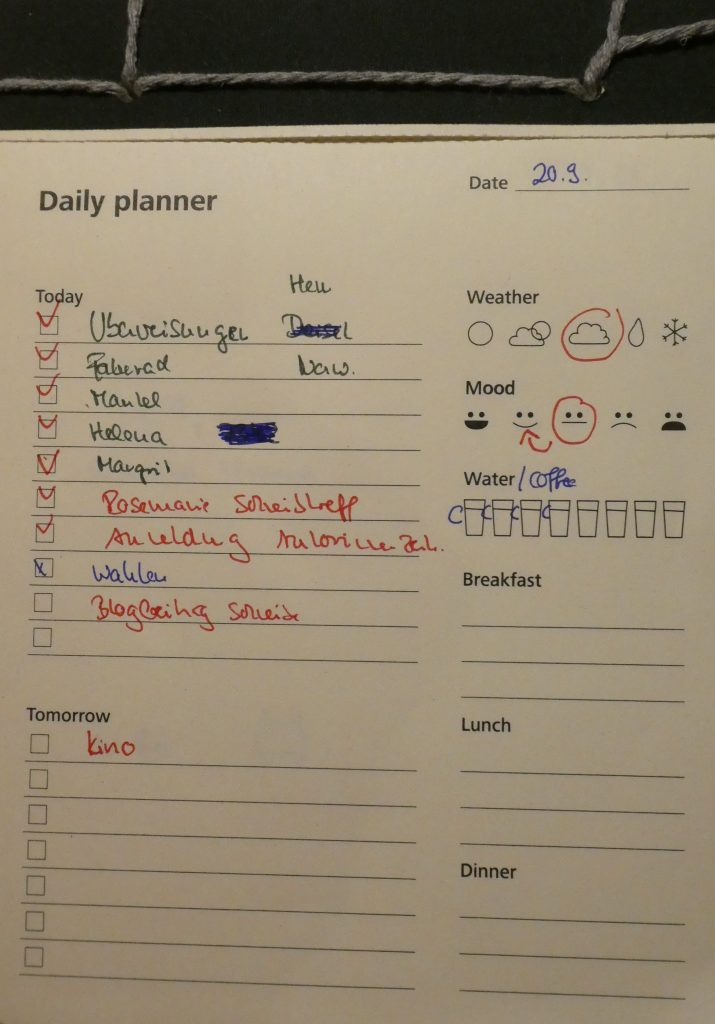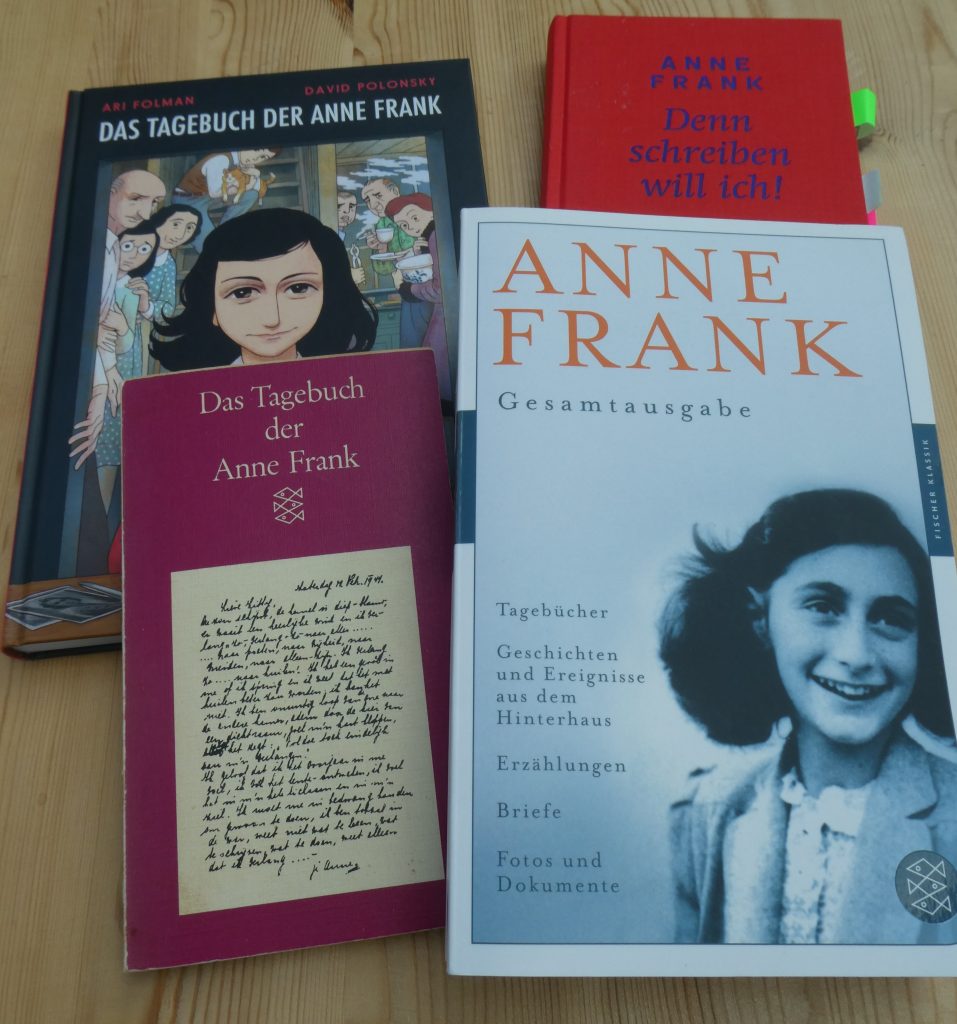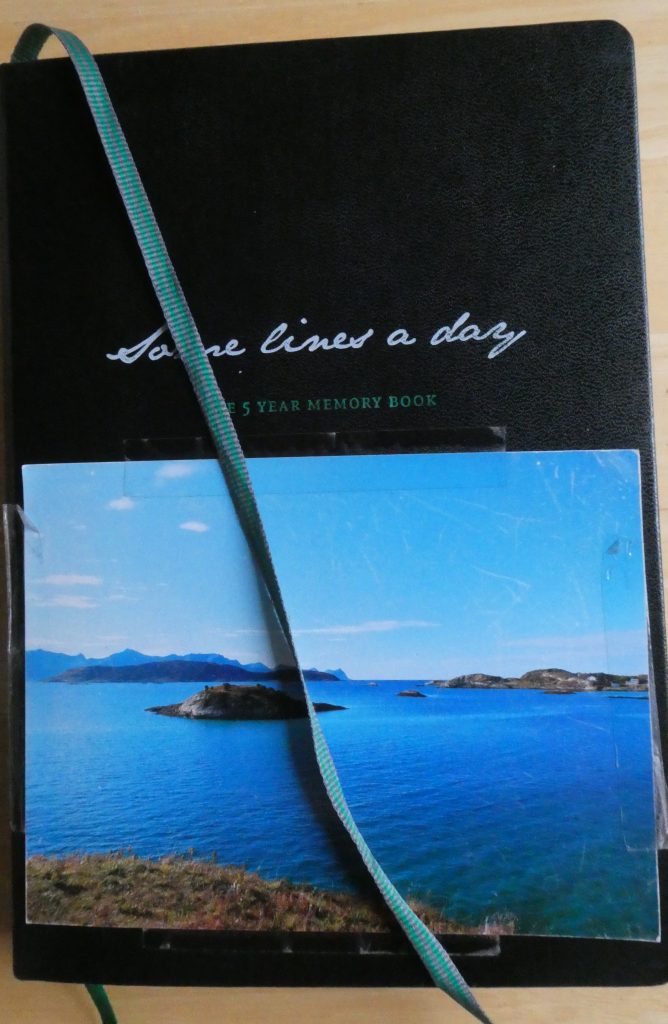Viel ist passiert, seit ich Anfang Juli den letzten Blogbeitrag veröffentlicht habe. Das Ahrtal und Teile von Nordrhein-Westfalen wurden überschwemmt, halbe Dörfer, Häuser, Brücken, Straßen wurden weggerissen, fast 200 Menschen starben. In Griechenland, in der Türkei und in Italien wüten Waldbrände, in Haiti gab es wieder mal ein Erdbeben mit mehr als tausend Toten. Von Klimawandel kann da sicher keine Rede mehr sein, eher von Klimakatastophe.
Eine Katastrophe ist auch das, was derzeit in Afghanistan passiert, und auch diese Katastrophe ist wie die Klimakatastrophe menschengemacht. Derzeit versuchen Tausende Menschen, aus Afghanistan zu fliehen. Sie belagern den Flughafen in der Hoffnung, irgendwie einen Platz in einem Flugzeug zu bekommen, das sie rausbringt aus diesem Land, weg von den Taliban, die die Macht wieder übernommen haben.
Nicht einmal zwei Monate ist es her, seit die letzten westlichen Soldatinnen und Soldaten Afghanistan verlassen haben, die Bundeswehr hat ihren Einsatz am 30. Juni beendet. Damit, dass die Taliban das Land so rasch erobern würden, haben offenbar weder PolitikerInnen noch Militärs gerechnet. Die Soldaten der afghanischen Armee, 20 Jahre lang ausgebildet und ausgestattet von der Nato, haben ihr Land und ihr Volk überhaupt nicht verteidigt, sondern sich und die Waffen kampflos den Taliban übergeben.
Die westlichen Länder haben, so scheint es, wieder einmal auf die Falschen gesetzt. Hinterher ist man natürlich klüger, aber ich bin sicher: Hätten man die Frauen bewaffnet und ausgebildet, sie hätten gewusst, wofür sie kämpfen, und hätten ihre Freiheit verteidigt. Manche, vielleicht sogar viele, wären lieber gestorben, als wieder ungeschützt den Taliban und ihren eigenen Männern, Brüdern, Vätern ausgeliefert zu sein, die gut ausgebildete Frauen mehr fürchten als die Scharia und den islamischen Staat. Der Männern die Macht sichert – im Staat und in der Familie.
Den islamische Staat wollten die USA und die Nato durch ihren Einmarsch im Jahr 2001 zwar verhindern. Doch in den Jahren davor haben sie die radikal islamischen Kräfte gestärkt und gepäppelt. Als nämlich sowjetische Truppen 1979 in Afghanistan einmarschierten, unterstützten vor allem die USA, Pakistan und Saudi-Arabien Guerilla-Gruppen, die gegen die Sowjets kämpften finanziell, materiell und ideologisch: Sie lieferten Waffen, bildeten die Kämpfer aus, die sich damals noch Mudschahedin nannten, und investierten Millionen in gewaltverherrlichende Lehrbücher, die afghanischen Schulkindern und afghanische Flüchtlingen in Pakistan die Lehre vom Dschihad, dem Heiligen Krieg, nahebringen sollten. Zumindest das ist offenbar sehr gut gelungen, und wenn Wikipedia recht hat, verwendeten auch die Taliban die von den USA produzierten Bücher.
https://de.wikipedia.org/wiki/Mudschahid#Mudschahidin_in_Afghanistan
Jetzt versuchen die Nato-Staaten, ihre Staatsangehörigen und zumindest einige AfghanInnen, die für sie gearbeitet haben, und deren Familien in Sicherheit zu bringen. Ob das gelingt, ist mehr als fraglich, denn auch am Flughafen gilt das Recht der Stärkeren. Viele Männer drängen sich vor, Frauen und Kinder zuletzt. Dabei müssten sie als Allererste außer Landes gebracht werden. Denn was mit den Frauen und Mädchen passiert, die in den letzten Jahren zur Schule gehen, berufstätig sein durften und ein etwas freieres Leben führen konnten, darf frau sich gar nicht ausmalen. Ihre Lage ist wirklich bedrohlich; deshalb möchte ich hier ausnahmsweise für Spenden an den Afghanischen Frauenverein e.V. (AFV) werben https://www.afghanischer-frauenverein.de/.
Der Afghanische Frauenverein fördert seit 1992 gezielt Projekte für Frauen und Kinder in Afghanistan. Jetzt vermittelt er dringend benötigte Hilfe in Form von Flugtickets, Lebensmittel, medizinische Versorgung – und braucht dafür Geld.
Denn nichts ist gut in Afghanistan. Als Margot Käßmann das vor fast zwölf Jahren in ihrer Neujahrsansprache sagte, wurde sie heftig kritisiert. Doch heute stimmen ihre Worte leider mehr denn je. Wer ihre beeindruckende Neujahrspredigt nachlesen möchte, findet sie unter dem folgenden Link
https://www.ekd.de/100101_kaessmann_neujahrspredigt.htm
Und noch etwas hat mich beeindruckt: das Gedicht „Das Trauerspiel von Afghanistan“. Nein, es wurde nicht in den letzten Wochen oder Monaten geschrieben, sondern von Theodor Fontane in der Mitte des vorletzten Jahrhunderts, etwa 1857 bis 1859.
Ich kannte die Ballade nicht, die vom traurigen Ende des ersten anglo-Afghanischen Kriegs erzählt. Ich muss gestehen, dass ich noch nicht einmal wusste, dass die Engländer drei Kriege in/gegen Afghanistan geführt haben, um ihre Vorherrschaft zu sichern und den Expansionsbestrebungen des damals noch von echten Zaren regierten Russischen Reichs Einhalt zu gebieten. Wie sich doch Ursachen und auch Folgen gleichen. The Great Game wurden die Auseinandersetzungen genannt, die für die, die ihre Köpfe hinhalten und ihr Leben lassen mussten, alles andere als ein Spiel waren. Der erste anglo-afghanische Krieg begann 1839 und endete 1842 mit dem Sieg Afghanistans, der vollständigen Vernichtung der Truppen von General William George Keith Elphinstone und dem vorläufigen Rückzug der Briten aus Afghanistan.
Im Januar 1842 traten 12.000 Zivilisten, 690 britische und 2.840 indische Soldaten den Rückzug aus Kabul an, weil die Stadt nach einer Revolte der Bevölkerung nicht mehr zu halten war. Obwohl die britische Führung freies Geleit ausgehandelt hatte, wurde der Zug immer wieder angegriffen; das erste Zwischenziel, das 140 Kilometer entfernte Dschalalabad, erreichte angeblich nur ein einziger Europäer, der junge Militärarzt Dr. William Brydon.
„Vernichtet ist das ganze Heer,
Mit dreizehntausend der Zug begann,
Einer kam heim aus Afghanistan“,
heißt die letzte Strophe von Fontanes Ballade. Wer sie ganz lesen möchte, findet sie unter
http://www.gruene-gruenberg.de/Downloads/afghanistan.pdf
Beim zweiten anglo-afghanischen Krieg von 1878 bis 1880 siegten dann die Briten. Sie annektierten etwa ein Drittel Afghanistans und bestimmten in den nächsten Jahren die afghanische Außenpolitik. Das änderte sich nach dem dritten anglo-afghanischen Krieg (Mai bis August 1919) wieder. Im Frieden von Rawalpindi erkannte Großbritannien Afghanistan provisorisch, im Vertrag von Kabul 1921 dann endgültig als souveränen und unabhängigen Staat an.
Aber auch 100 Jahre nach der Souveränität ist nichts gut in Afghanistan – und von der Unabhängigkeit sind zumindest die afghanischen Frauen leider immer noch unendlich weit entfernt.