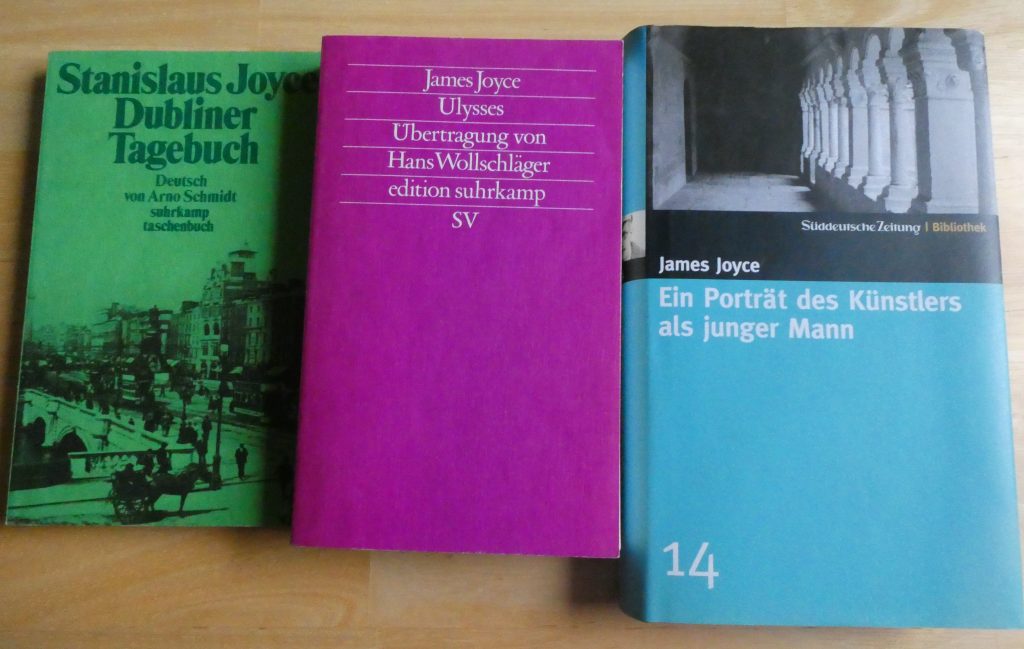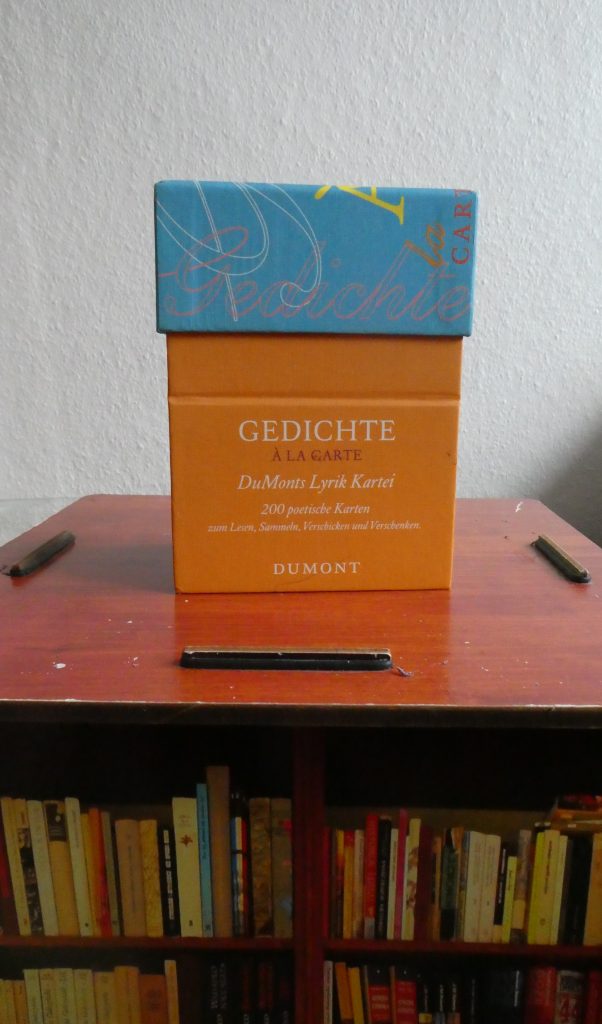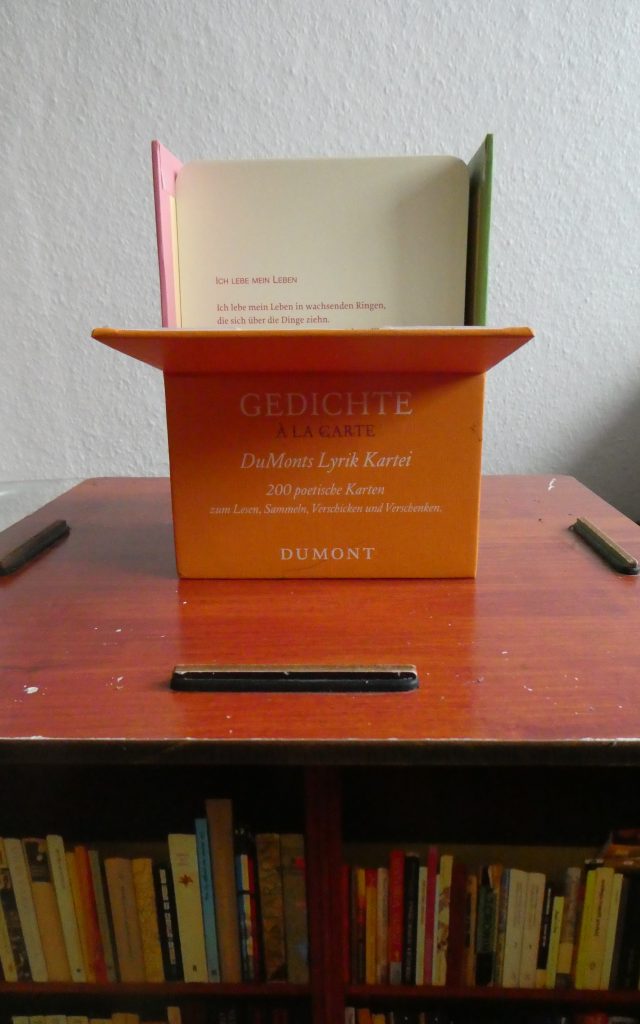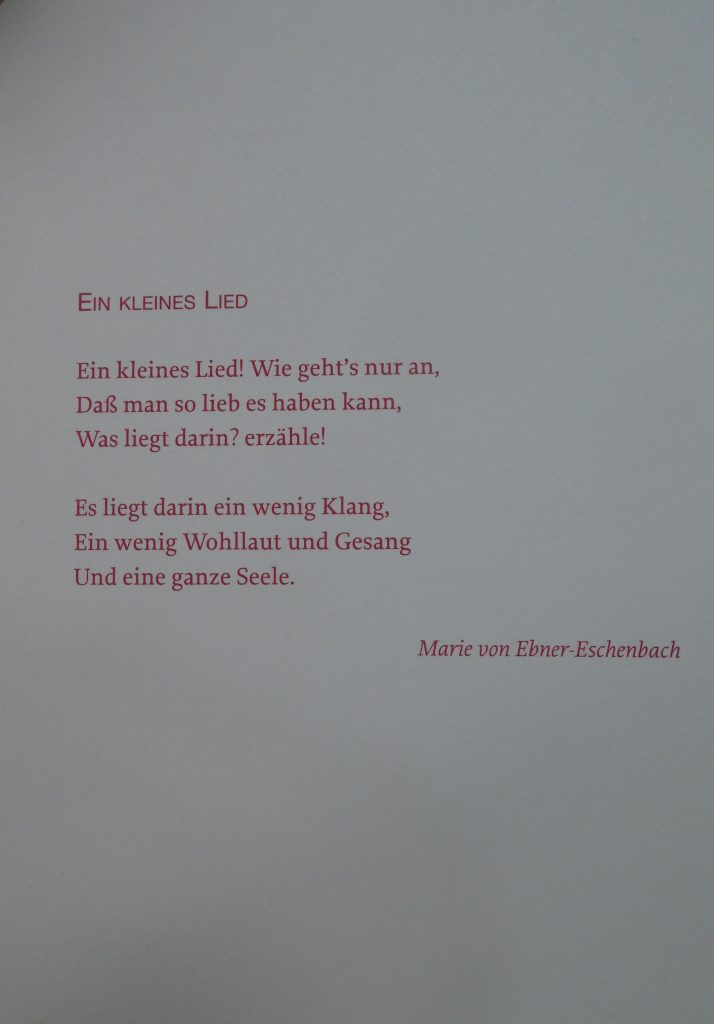Bei der Suche nach einem „fliegenden“ Gedicht (https://timetoflyblog.com/noch-ein-Versuch-fliegende-Gedichte) bin ich Anfang letzter Woche auf ein Gedicht von Ingeborg Bachmann gestoßen, das ich wohl in der achten oder neunten Klasse gelernt habe: „Alle Tage“ ist ein Antikriegsgedicht; trotzdem – oder gerade deshalb – passt es meiner Meinung nach gut in diese Zeit. Es wurde Anfang der 50er-Jahre erstmals veröffentlicht und beginnt mit den Worten
„Der Krieg wird nicht mehr erklärt,
sondern fortgesetzt. Das Unerhörte
ist alltäglich geworden.“
Als Ingeborg Bachmann das Gedicht schrieb, standen sich die Westmächte unter Führung der Vereinigten Staaten von Amerika und der sogenannte Ostblock unter Führung der Sowjetunion feindlich gegenüber. Viereinhalb Jahrzehnte dauerten die Feindseligkeiten und das Wettrüsten; nach dem Ende des kalten Krieges war ich wie viele meiner Generation überzeugt, dass es nie wieder Krieg mehr in Europa geben würde. Wir wurden durch den russischen Überfall auf die Ukraine eines Schlechteren belehrt.
Meine Überzeugung, dass man Frieden ohne Waffen schaffen kann, erweist sich als Illusion, seit Putin die Ukraine überfallen hat. Er tritt das Völkerrecht mit Füßen, lässt seine Armee Tod, Angst und Schrecken verbreiten. Ich bewundere den Mut der UkrainerInnen, die zu den Waffen greifen, um ihre Heimat und ihre Freiheit gegen die übermächtigen russischen Aggressoren zu verteidigen. Aufgeben ist für sie – auch zu unserem Glück – keine Option.
Aber die Lage in ihrem Land ist katastrophal. Wohn- und Krankenhäuser, Kindergärten und AKWs werden angegriffen. Städte wie Mariupol, Lwiw, Kiew werden belagert, zerbombt und zerstört. Lebensmittel, Medikamente, Energie sind knapp. Immer mehr Menschen sterben oder werden verletzt. „Der Schwache ist“, um Ingeborg Bachmann zu zitieren, „in die Feuerzonen gerückt“. Und die kommenden Tage werden in der Ukraine „wahrscheinlich noch größere Not bringen“, befürchtet Nato-Generalsekretär Stoltenberg (https://www.tagesschau.de/newsticker/liveblog-ukraine-sonntag-105.html). Eigentlich bleibt nur die Hoffnung, dass die UkrainerInnen weiter Stand halten – und dass auch in Russland selbst der Widerstand gegen diesen sinnlosen, gegen das Völkerrecht verstoßenden Krieg wächst: unter der Bevölkerung, aber auch im Militär, bei den einfachen Soldaten und ihren Befehlshabern.
Der Krieg wird nicht nur mit Waffen geführt, sondern auch mit Worten. Dass Putin die Presse- und Meinungsfreiheit in Russland noch mehr einschränkt als bisher, zeigt, wie sehr er die Macht der Worte und die Wahrheit fürchtet. Wer den Krieg gegen die Ukraine Krieg nennt, riskiert in Russland 15 Jahre Haft.
Vielleicht sollte man der plumpen Propaganda der russischen Machthaber die wohl subtilste Form der Sprache entgegenstellen: die Lyrik. Die hat, glaubt man dem Slawisten und Kulturwissenschaftler Rolf Dieter Kluge, in Russland einen hohen Stellenwert.
„Rußland lebt mit dem Gedicht. Es gibt wohl kaum ein anderes Land, in dem der Dichter populär ist wie ein Filmstar oder Volkstribun, wo sich Tausende versammeln, um Verse zu hören, wo einfache Menschen in gehobener Stimmung nicht nur Lieder singen, sondern Gedichte deklamieren, wo ein durchschnittlich Gebildeter Hunderte und mehr Verse auswendig weiß“, schrieb Kluge vor einigen Jahren in einem Vorwort zu einer Anthologie russischer Lyrik. „In Moskaus Fußgängerzone, auf dem Arbat, bilden sich um gänzlich unbekannte Poeten und Laiendichter, die dort ihre Gedichte rezitieren, engagiert teilnehmende und diskutierende Zuhörergruppen.“ http://www.planetlyrik.de/russische-lyrik-im-20-jahrhundert/2019/01/
Man sollte vielleicht Ingeborg Bachmanns Gedicht ins Russische übersetzen und im Land verteilen: an Menschen, die Literatur lieben, an die Mütter und Väter, deren Söhne in den Krieg geschickt werden, und an die Soldaten selbst, die oft gar nicht wissen, wo und gegen wen sie kämpfen.
Die Auszeichnung, heißt es in der letzten Strophe , verdienen sie
„für die Flucht von den Fahnen,
für die Tapferkeit vor dem Freund,
für den Verrat unwürdiger Geheimnisse
und die Nichtachtung
jeglichen Befehls.“
Sie retten damit nicht nur ihr eigenes Leben.
Das ganze Gedicht ist nachzulesen unter