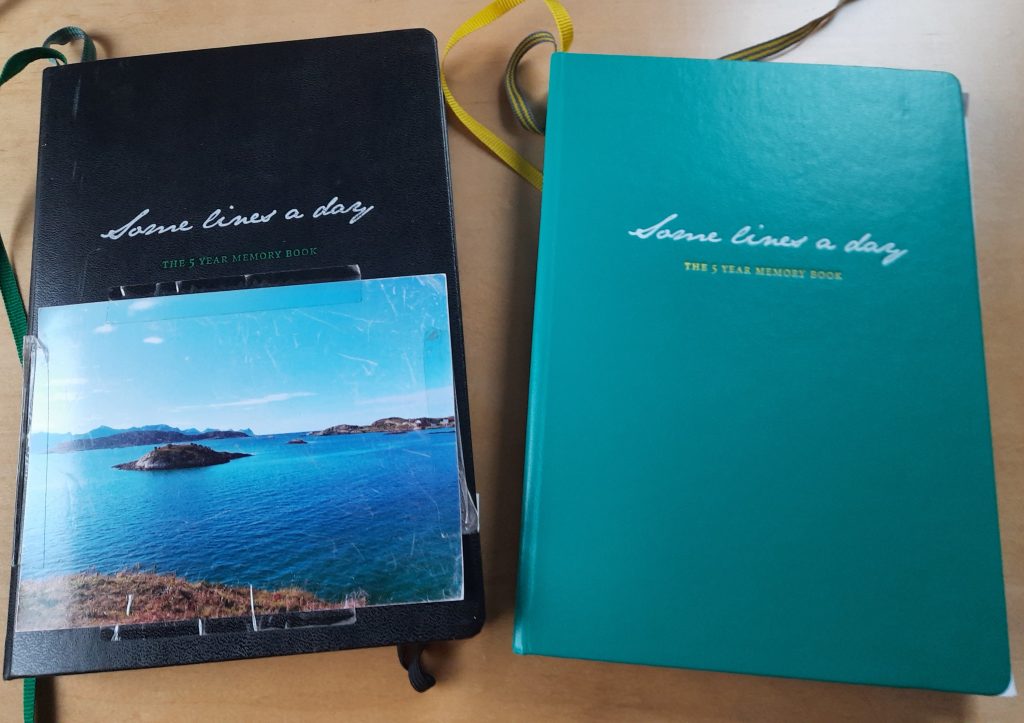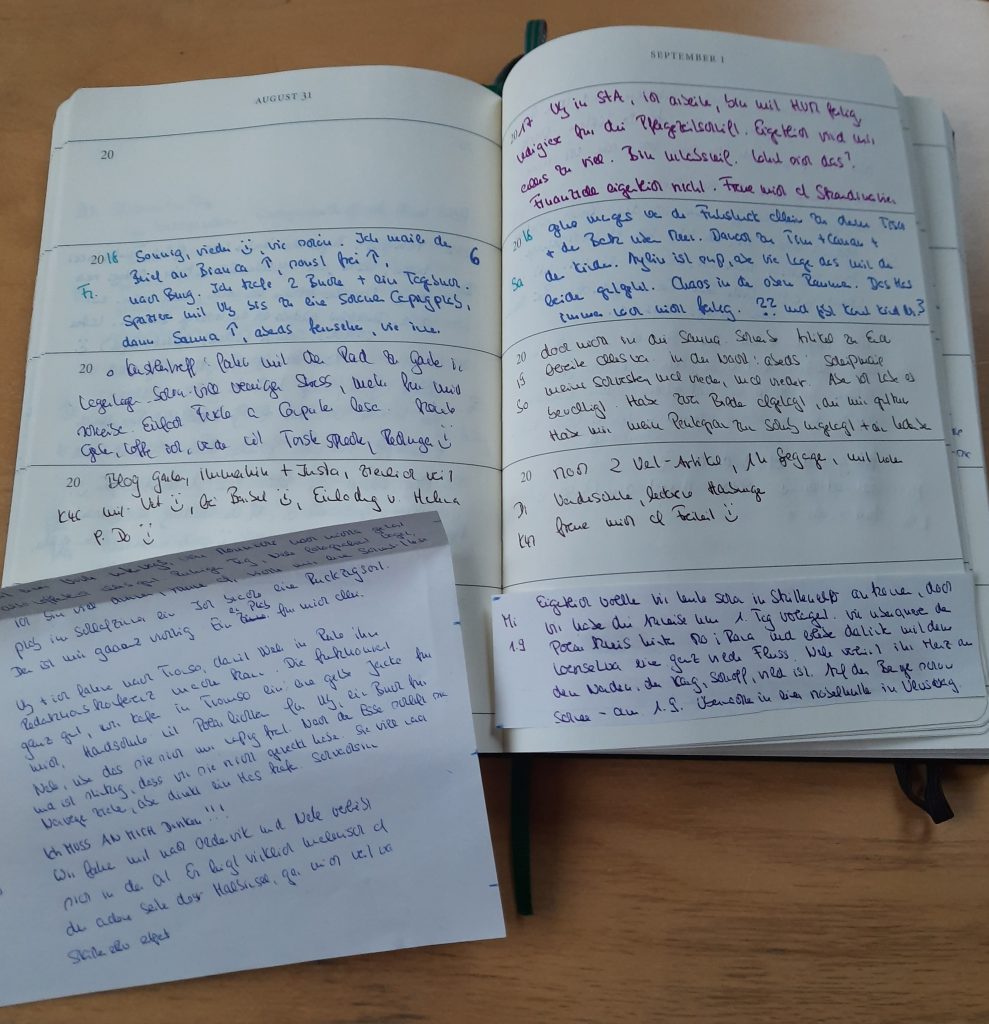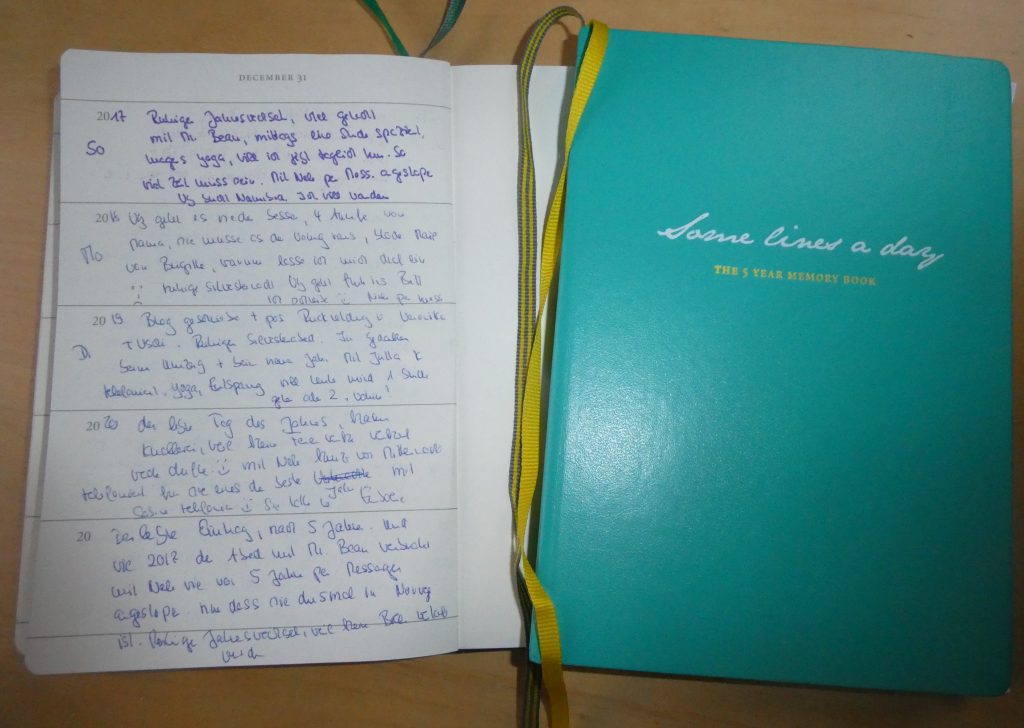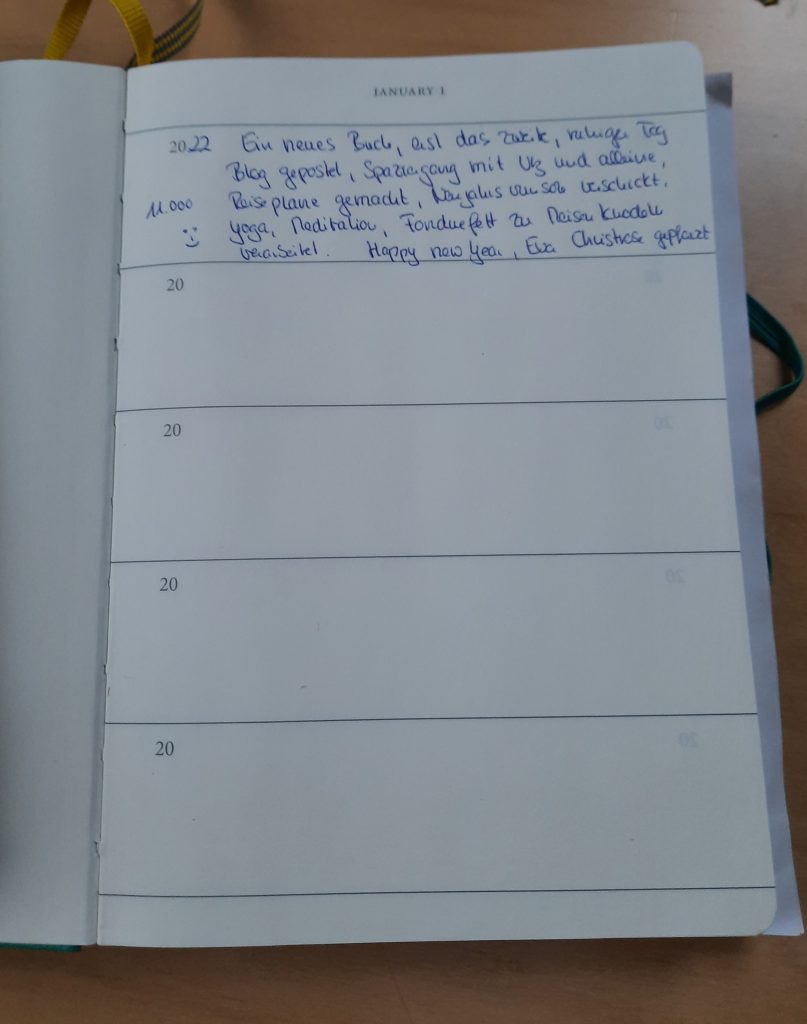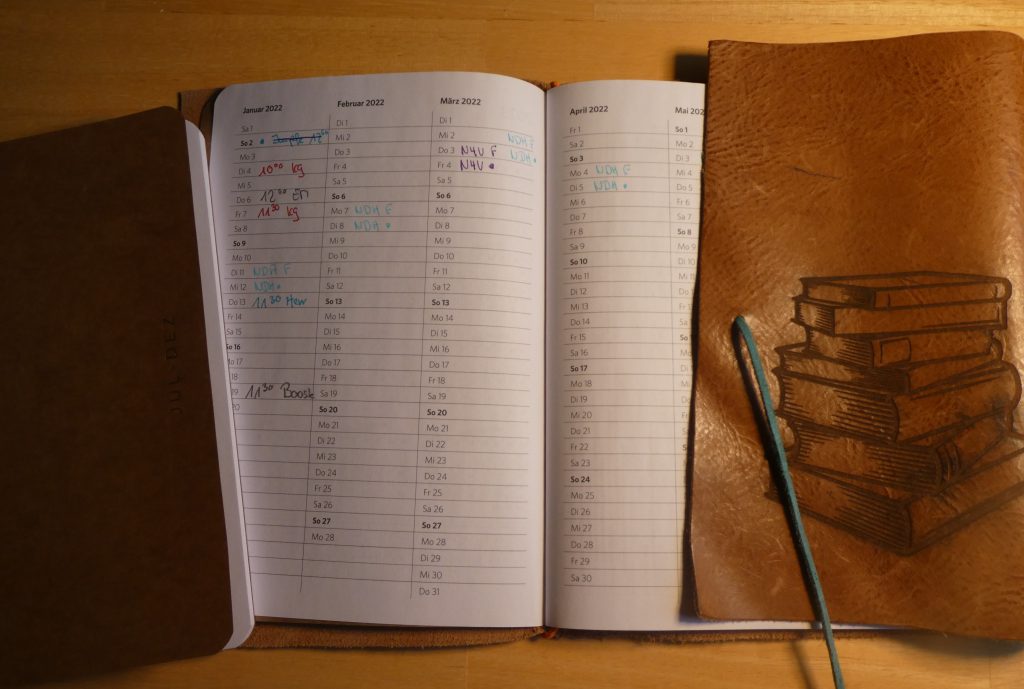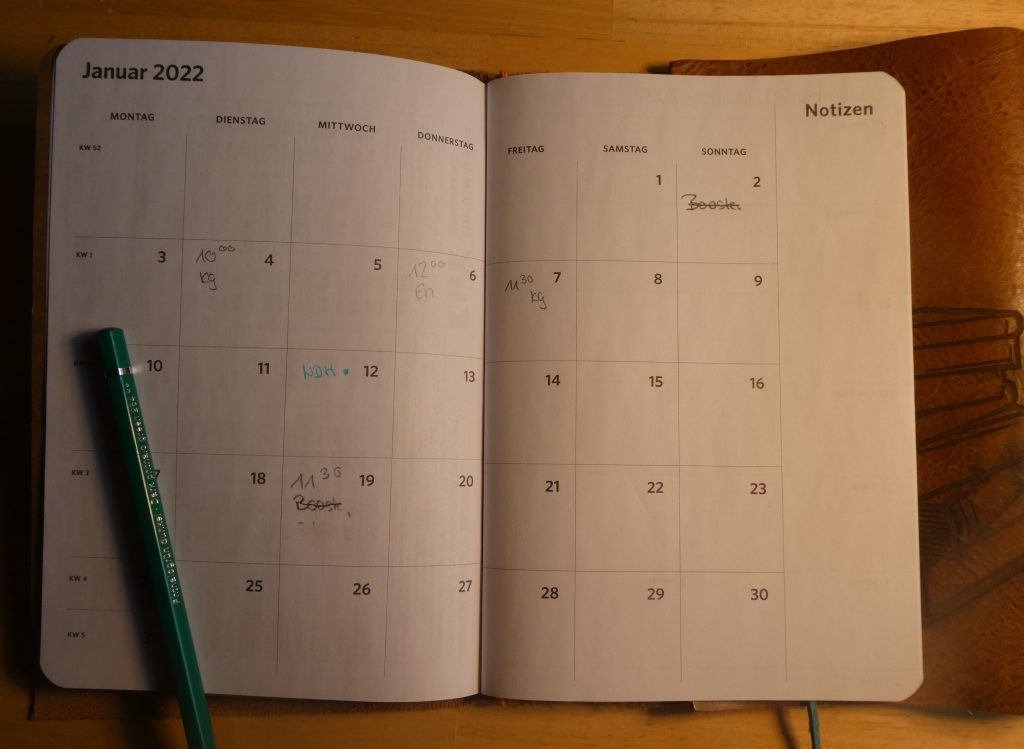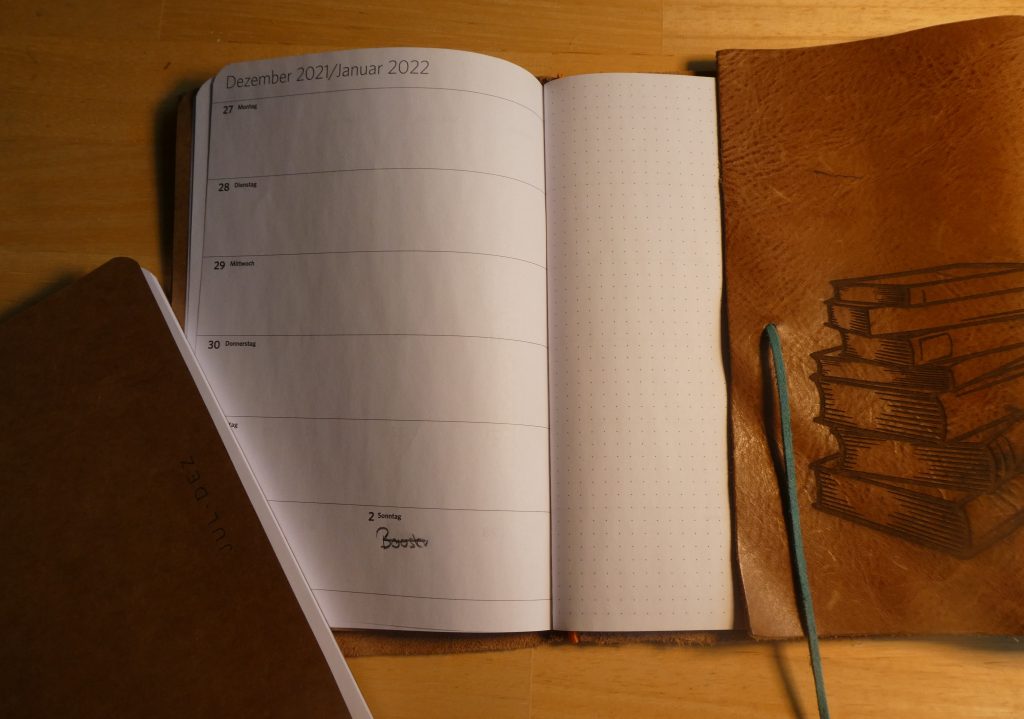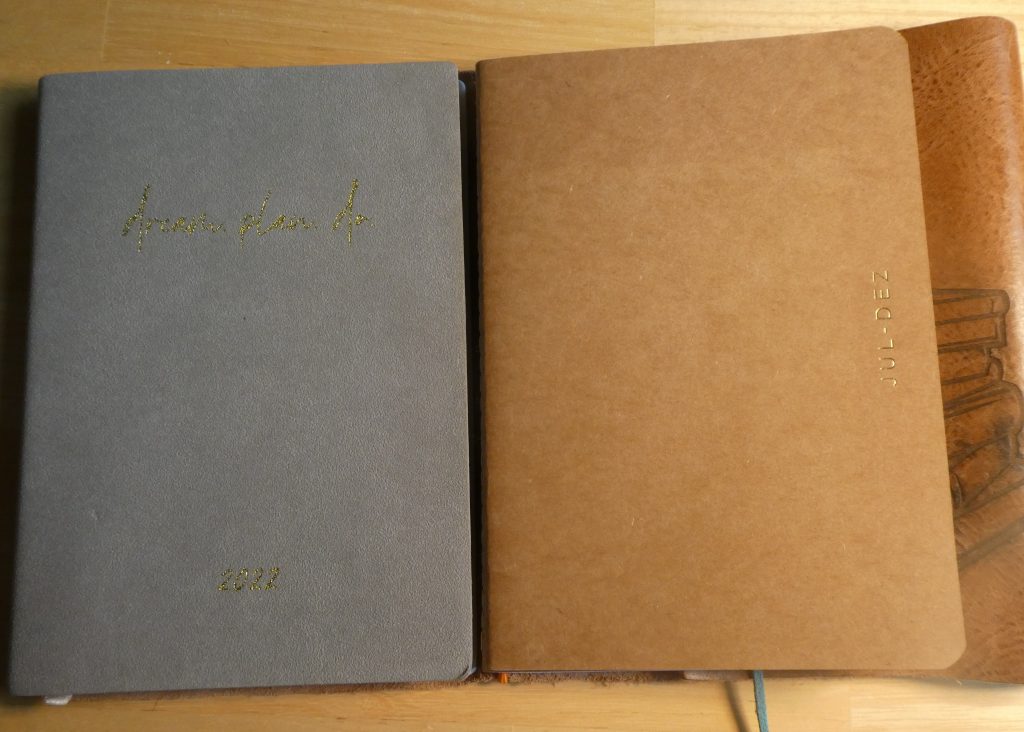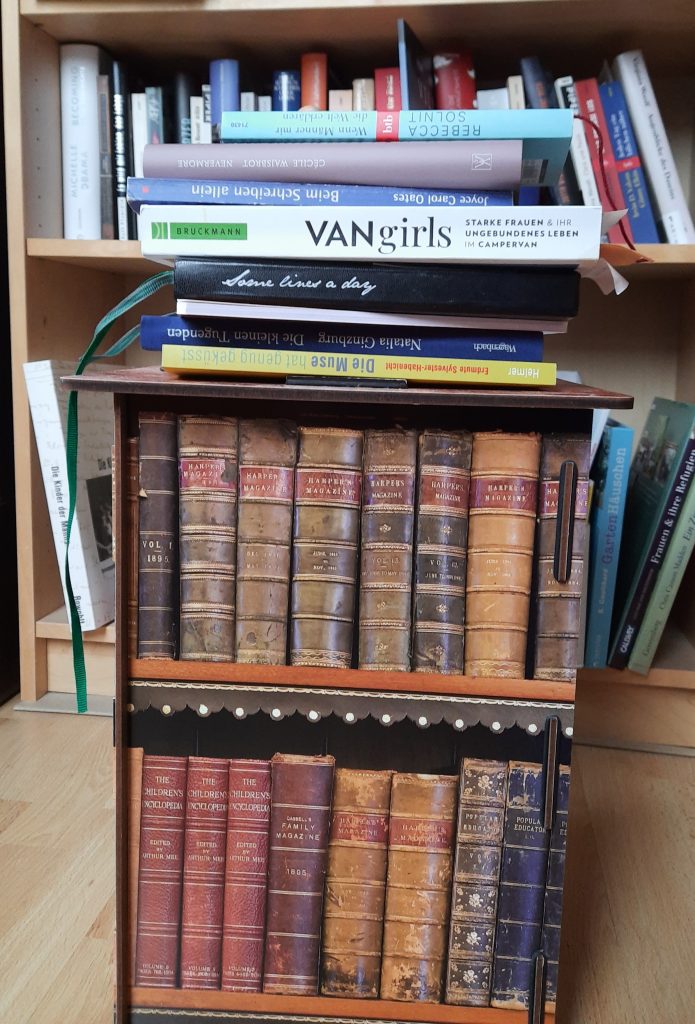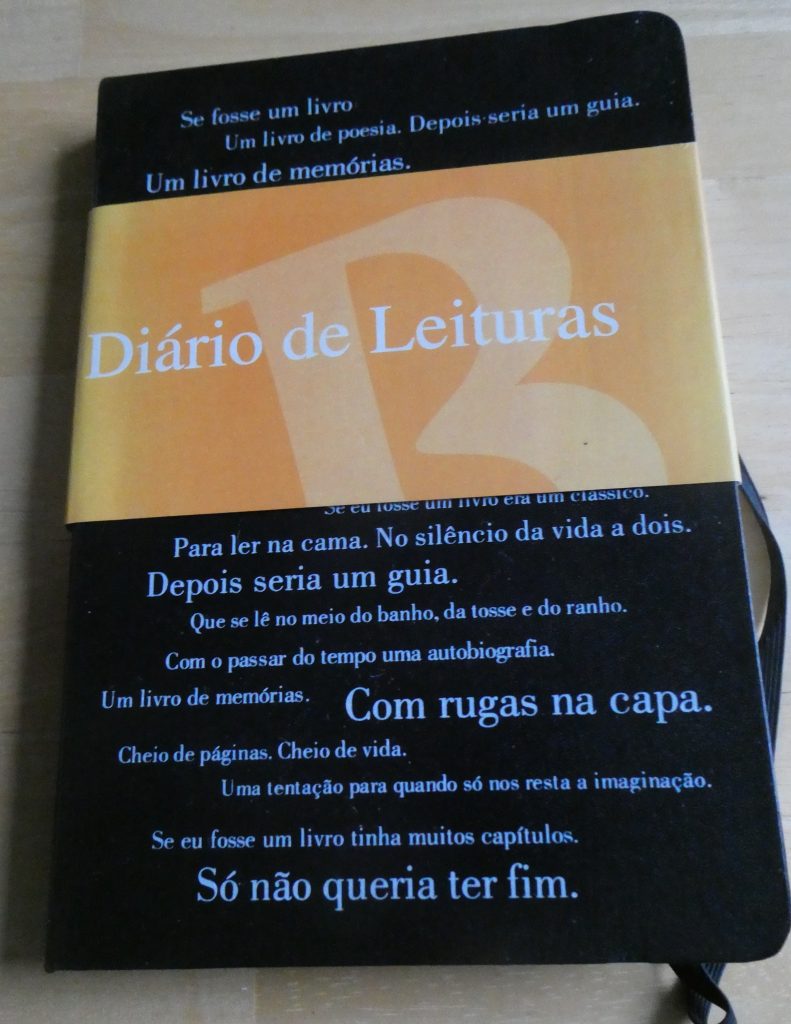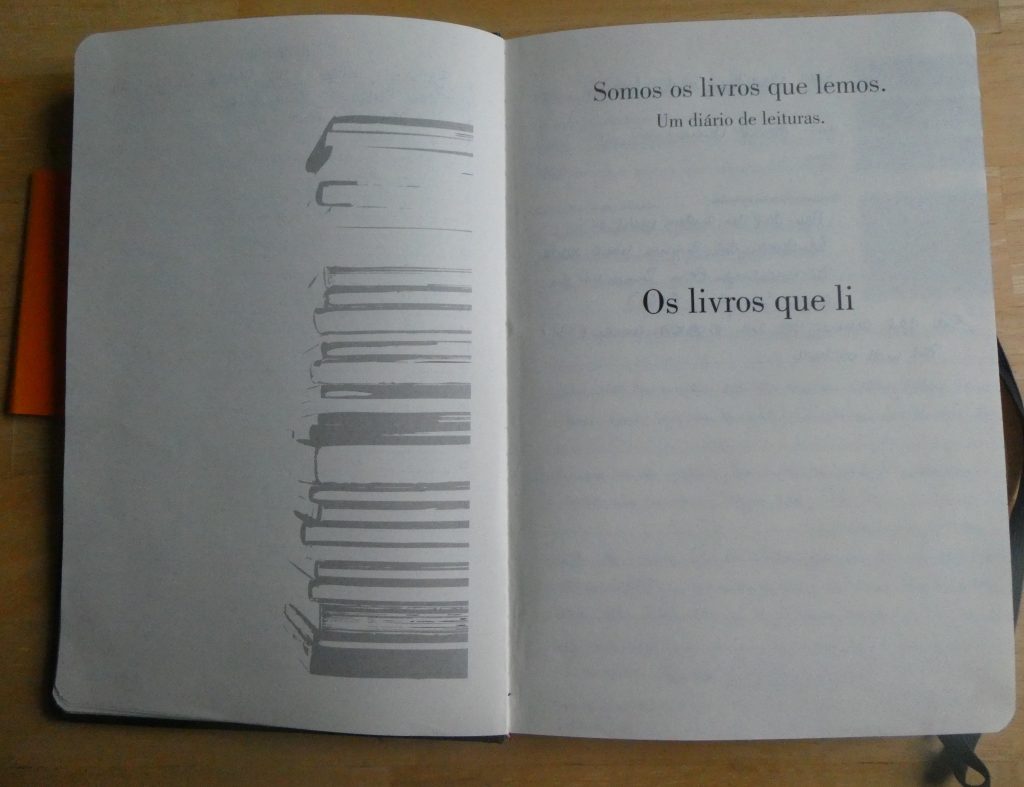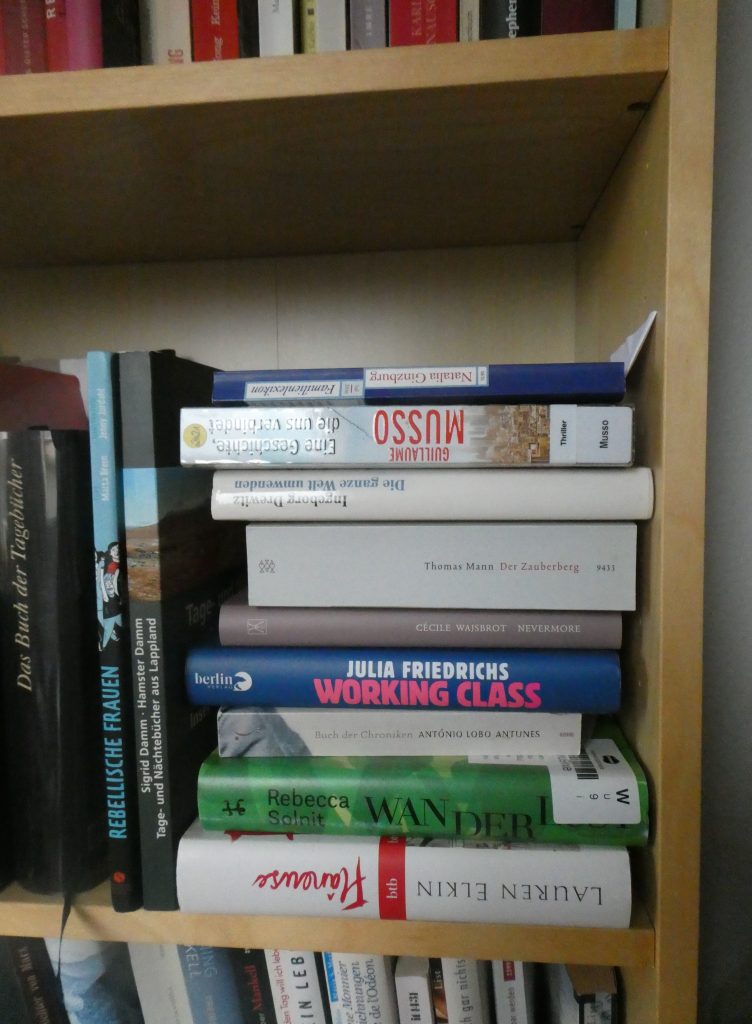Nun ist sie vorbei, die erste Arbeitswoche im neuen Jahr, das für mich das letzte Arbeitsjahr sein wird. Denn im Oktober gehe ich in Rente: Ich höre dann zwar nicht ganz auf zu arbeiten, denn mein Beruf macht mir immer noch Spaß. Aber ich werde sicher weniger arbeiten als in der Vergangenheit.
Der Übergang zum neuen Dasein als Rentnerin gestaltet sich fließend. Denn wie viele Selbstständige im Medienbereich habe ich seit Beginn der Corona-Pandemie Aufträge verloren. So wurden beispielsweise viele Korrekturaufträge, die an Freie wie mich vergeben waren, vor nun fast zwei Jahren storniert; die meisten wohl auf Dauer. Zeitschriften leben ja bekanntlich von Anzeigen – und wenn es weniger Anzeigenaufträge gibt, wird eben da gespart, wo es am einfachsten scheint. Wem fällt es schon auf, wenn „dass“ nur mit einem s geschrieben wird, wo eigentlich zwei hingehören – und umgekehrt? Oder dass der ehemalige Oberbürgermeister von Hannover nicht Stephan, sondern Stefan heißt?
Dass ich Aufträge verloren habe, belastet mich nicht (mehr): Den meisten weine ich keine Träne nach. Und einen Auftrag hätte ich eigentlich schon lange kündigen wollen oder sollen, weil er mir mehr Frust als Lust bereitete. Ich habe natürlich gut reden. Finanziell bin ich durch die freiwillige Arbeitslosenversicherung für Selbstständige und natürlich auch durch die Pension meines Mannes abgesichert. Und um meine berufliche Zukunft muss ich mir – anders als viele jüngere Kolleginnen und Kollegen – keine Sorgen mehr machen: Ich gleite auf die Rente hin, kann mich allmählich an den arbeitsfreien Zustand gewöhnen. Das tue ich – und ich tue es gerne. Es gefällt mir, dass ich Aufträge loslassen kann, die keinen Spaß machen, sondern nur belasten. Und dass ich nicht mehr jeden Auftrag annehmen muss, auch wenn er noch so ungelegen kommt, aus Angst, ich könnte mir durch eine Absage einen Folgeauftrag vermasseln. Das Los vieler Freier.
Natürlich schaue ich nicht sorgenfrei in die Zukunft oder auch nur in das vor uns liegende Jahr. Im Gegenteil: Ich bin ausgesprochen gut im Sorgen machen, wie ein winziger Auszug aus meiner ungeschriebenen Sorgenliste zeigt. Reicht meine Rente? Wie geht es mit Corona weiter? Werden die Impfgegner noch radikaler, noch gefährlicher – hierzulande und anderswo? Ja, die Leerdenker-Bewegung macht mir zunehmend Angst: Hier verbünden sich scheinbar ganz normale Bürgerinnen und Bürger mit Geistern, die sie vielleicht nicht mehr los werden. Haben sie aus der Geschichte wirklich nichts gelernt. Fackelaufzüge, Todesdrohungen und Todeslisten erinnern an Deutschlands dunkelste Zeiten, die wir doch für immer hinter uns geglaubt hatten.
Mascha Kaléko, meine Lieblingslyrikerin, hat diese Zeit erlebt und erlitten: Die Nazis haben ihre Karriere zerstört; weil sie Jüdin war, wurden ihre Bücher als „schädliche und unerwünschte Schriften“ verboten. 1938 floh sie mit Mann und Kind in die USA, aber der berufliche Neustart war dort für eine Dichterin und einen Musikwissenschaftler nicht leicht. Mascha Kaléko hielt die Familie mit Werbetexten über Wasser und veröffentlichte Texte in der deutschsprachigen jüdischen Exilzeitung Aufbau. Im amerikanischen Exil schrieb sie, sicher in prekären Verhältnissen lebend, unter anderem auch „Rezept“, eines mein Lieblingsgedicht. Es beginnt mit den Zeilen
„ Jage die Ängste fort
und die Angst vor den Ängsten.
Für die paar Jahre
wird wohl alles noch reichen“
Ich finde, das ist ein guter Rat. Ich möchte ihn mir zu Herzen nehmen, für das noch neue Jahr und für meine Zukunft.
Wer das Gedicht nachlesen will, findet es in dem von Gisela Zoch-Westphal und Eva-Maria Prokop herausgegeben Buch: „Sei klug und halte dich an Wunder“. Es ist und enthält neben dem Gedicht noch viele andere lesenswerte Gedanken Mascha Kalékos über das Leben. Eine Leseprobe aus dem bei dtv erschienenen Buch mit dem Gedicht gibt es im Internet unter https://www.dtv.de/_files_media/title_pdf/leseprobe-14256.pdf
*Dieser Beitrag enthält unbezahlte Werbung
Mascha Kaléko: Sei klug und halte dich an Wunder, Gedanken über das Leben. Hrsg. von Gisela Zoch-Westphal und Eva-Maria Prokop, dtv Verlagsgesellschaft, 2013, 10 Euro