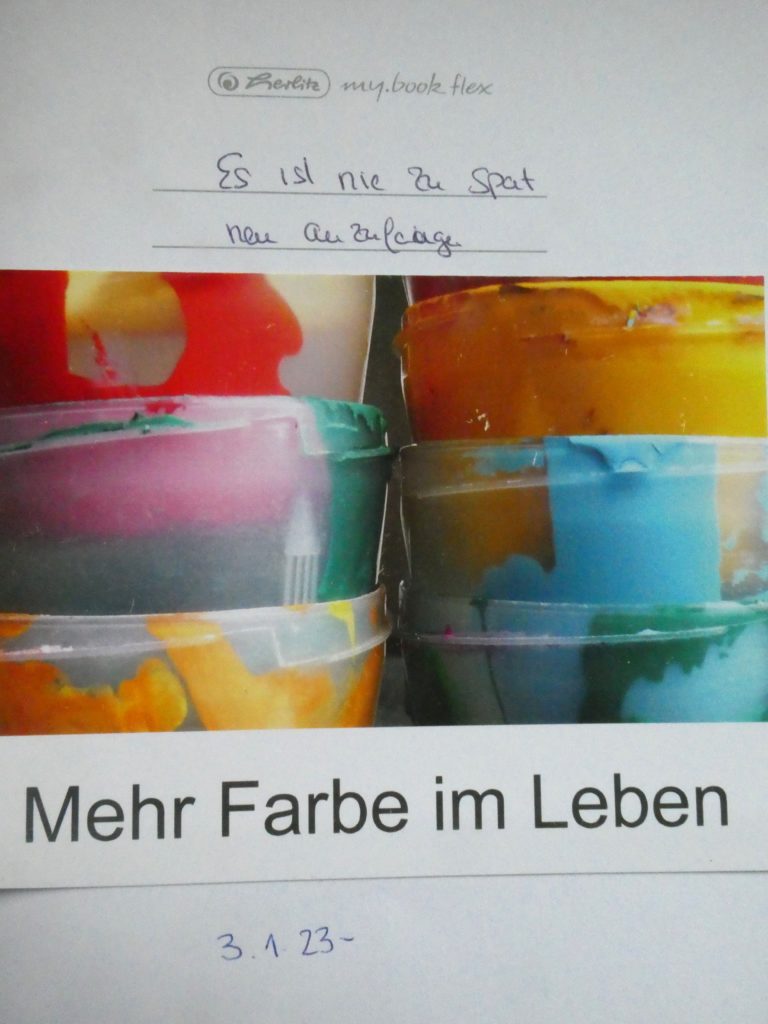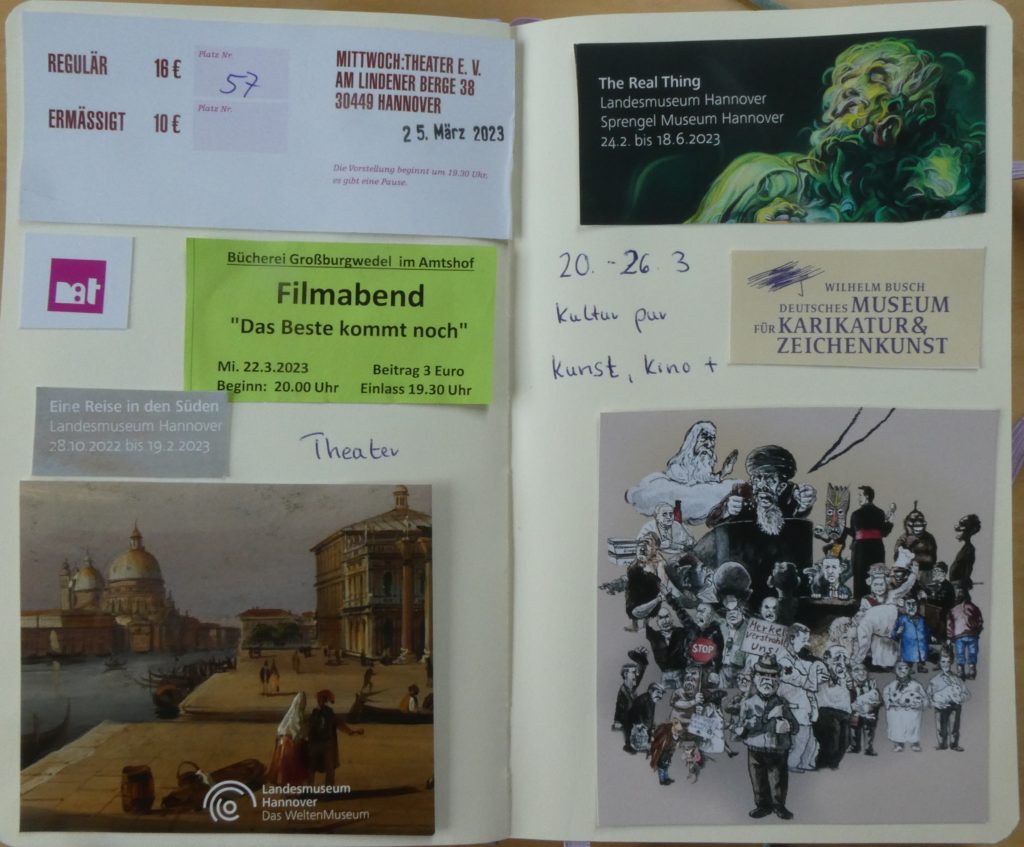Eigentlich wollte ich ja am Samstag auf den Brocken wandern, aber weil mein Knie mal wieder nicht so wollte wie ich, schien mir eine Wanderung auf den höchsten Berg Norddeutschlands keine allzu gute Idee. Denn wer hinaufgeht, muss auch wieder zu Fuß hinab – von der Wohnung, in der ich am Wochenende die Katze gehütet habe, bis nach Torfhaus sind das gut 24 Kilometer und zahlreiche Höhenmeter. Außerdem ist der Brocken samstags – noch dazu an einem langen Herbstwochenende mit strahlend schönem Wetter – ein beliebtes Ausflugsziel und daher ziemlich überlaufen. Das Gleiche gilt auch für die Teufelsmauer bei Blankenburg. Also musste ein Alternativziel her.
Wolfenbüttel ist von Bad Harzburg aus mit der Bahn und meinem 49-Euro-Ticket bequem und schnell zu erreichen – im Stundentakt und in weniger als einer Dreiviertelstunde. Kennenlernen wollte ich die Stadt schon lange mal: Schließlich galt die 1570 gegründete „Bibliotheca Augusta“, die heutige Herzog August Bibliothek, einst als achtes Weltwunder (https://www.lessingstadt-wolfenbuettel.de/). Noch heute werden in ihr einzigartige Bücher bewahrt und gezeigt, unter anderem das Evangeliar Heinrichs des Löwen.
Zumindest zwei Bibliothekare, die dort arbeiteten, waren noch berühmter als die Bibliothek: 1621 übernahm der Universalgelehrte Gottfried Wilhelm Leibniz die Leitung der Bibliotheca Augusta – und entwickelte in dieser Zeit „nebenbei“ das binäre System, die Grundlage der heutigen IT-Technik. 150 Jahre später, im Jahr 1770, wurde Gotthold Ephraim Lessing dort Bibliotheksleiter – wohl mehr aus Not, denn aus Überzeugung. Denn obwohl Lessing damals schon ein bekannter Schriftsteller war, plagten ihn finanzielle Sorgen – offenbar war es schon damals schwer bis unmöglich, nur vom Schreiben zu leben. Der Job als Bibliothekar brachte ihm „sechs hundert Thaler Gehalt, nebst freyer Wohnung und Holz auf dem fürstl. Schloße“. Seine Pflichten hielten sich in Grenzen: „Eigentliche Amtsgeschäfte habe ich keine andere als die ich mir selbst machen will. … Ich darf mich rühmen, dass der Erbprinz mehr darauf gesehen, dass ich die Bibliothek als dass ich der Bibliothek nutzen soll“, schrieb Lessing am 27. Juli 1770 seinem Vater. So blieb ihm viel Zeit zu reisen und zu schreiben: In Wolfenbüttel entstanden unter anderem Emilia Galotti, sein wohl bekanntestes Werk Nathan der Weise und sein religionsphilosophisches Hauptwerk „Die Erziehung des Menschengeschlechts“ (1780).


Im Lessinghaus wohnte und arbeitete Lessing nach seiner Heirat mit Eva König im Jahr 1777. Heute ist das Haus teilweise ein Museum, und natürlich habe ich es besucht: eine wahrlich hübsche Dienstwohnung. Von der direkt daneben liegenden Bibliothek konnte ich leider nur die neoklassizistische Fassade betrachten. Denn „die musealen Räume der Bibliothek sind für den Publikumsverkehr auf unbestimmte Zeit geschlossen“, heißt es auf der Bibliotheks-Website. Schade. Ich hätte mir die Büchersammlung allzu gerne angesehen. Aber so habe ich einen Grund wiederzukommen, wenn die Sanierungsarbeiten abgeschlossen sind.


Auf die Schlossbesichtigung habe ich dagegen bewusst verzichtet und bin lieber durch die Stadt gebummelt. Sie hat mit rund tausend meist schön restaurierten Fachwerkhäusern und vielen kleinen Läden wirklich ein besonderes Flair.


Ich mag Städte am Wasser. Wolfenbüttel liegt an der Oker, wird von einem Stadtgraben umschlossen und von zahlreichen Kanälen durchzogen. Sie wurden ab 1542 in der Regierungszeit Herzog Julius‘ angelegt, um die sumpfige Okeraue zu entwässern und die Stadt umbauen und erweitern zu können. Fluss und Grachten waren wichtige Lebensadern der Stadt, sie dienten früher als Transportwege, trieben Mühlen an und leider wurden in ihnen auch Abfälle und Abwasser entsorgt. Die Folge: Oker und Grachten waren damals Kloaken, die zum Himmel stanken: „Im Jahr 1899 werden 168 Tonnen Kot, 7.800 Tonnen Urin, 1.700 Tonnen Kehrricht und 480.000 Tonnen sonstiges Abwasser in die Oker geleitet“, erfahre ich auf dem Audio-Rundgang „Wasserwege Wolfenbüttel“ (www.wasserwege-wf.de), die mich zu fünf Stationen leitet. Die Wasserqualität hat sich glücklicherweise erheblich verbessert. Aber leider wurden große Teile der Wasserwege, die einst das Stadtbild prägten, inzwischen unter die Erde verbannt. Dass beispielsweise unter der Straße Krambuden ein Seitenarm der Oker hindurchfließt, merkt man nicht, wenn man durch die Stadt schlendert. In Klein Venedig ist dagegen noch ein kleines Stück des Großen Kanals zu sehen.

Bedeutende Kirchen gibt es in Wolfenbüttel natürlich auch: Die Trinitatiskirche zählt laut Wikipedia zu den bedeutendsten Kirchen im Barockstil in Deutschland https://de.wikipedia.org/wiki/St.-Trinitatis-Kirche_(Wolfenbüttel). Nur die Außenmauern wurden aus Stein gemauert, im Inneren wurde Holz verbaut. Dass die Säulen aus je vier verschalten Tannenstämmen bestehen, sieht man ihnen nicht an. Die Hauptkirche Beatae Mariae Virginis, angeblich der erste bedeutende protestantische Großkirchenbau der Welt https://de.wikipedia.org/wiki/Marienkirche_(Wolfenbüttel), war leider über Mittag geschlossen.


Und so bin ich stattdessen in eine Buchhandlung und ein Antiquariat gegangen, die beide schräg gegenüber der Hauptkirche am Kornmarkt liegen. Eigentlich ein passender Abschluss für den Besuch in einer Stadt, die vor allem wegen eines Schriftstellers, der einst dort lebte und arbeitete, und ihrer besonderen Bibliothek bekannt ist.