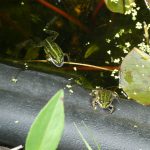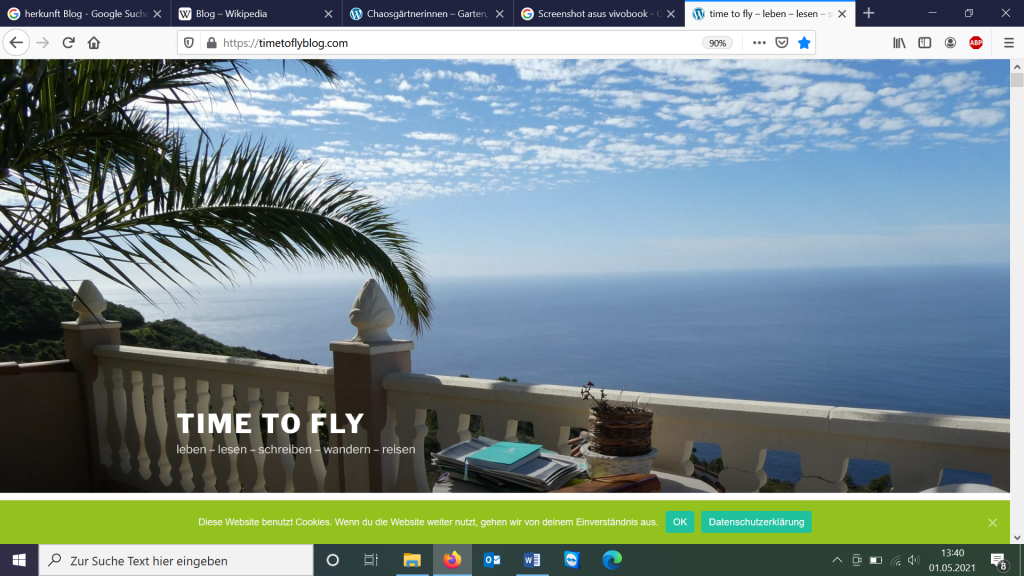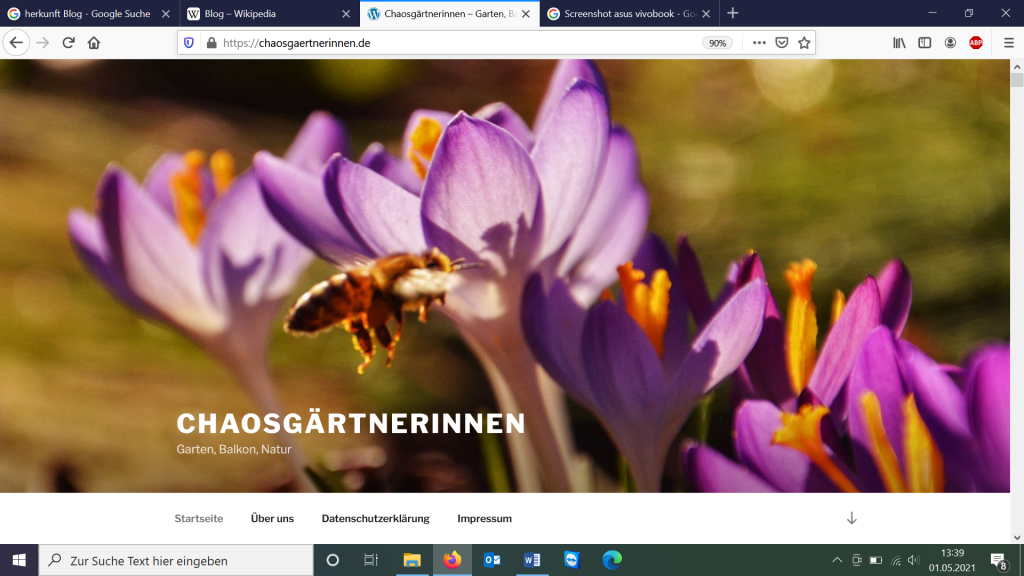Sie sind wieder geöffnet, die Gartenpforten in und um Hannover. Im vergangenen Jahr ist die Aktion wegen Corona ausgefallen – in diesem Jahr geht es weiter. Insgesamt 112 Gärten können bis zum 10. Oktober in der Region Hannover besichtigt werden, allein am ersten Juni-Wochenende beteiligten sich 39 Gartenbesitzerinnnen und -besitzer am Rendez-vous im Garten: Sie ermöglichten unter dem Motto „Wissen, das wandert“ Gartenfans wie mir einen Blick hinter den Zaun.
Ich habe am vergangenen Wochenende drei Gärten besucht – alle toll und alle ganz anders, obwohl ja in allen dreien die gleichen Pflanzen blühen. Akeleien zum Beispiel, die zu meinen Lieblingen gehören, Fingerhut, Heckenrosen und Mohn.
Der Garten Schwertmann in der Wedemark, Garten Nummer eins auf meiner Besuchsliste, ist eine gelungene Mischung aus Nutz- und Naturgarten, eine sehr gelungene sogar. Im Gemüsegarten mit mehreren Hochbeeten herrscht eine bewundernswerte Ordnung: Hier steht – wie es sich für einen Nutzgarten gehört – zusammen, was zusammengehört. In Reih und Glied, so wie ich es aus meiner Kindheit kenne, als meine Eltern und meine Oma in unserem Garten noch Kartoffeln, Erdbeeren, Salat und Gemüse angepflanzt haben.
Viel schöner als den Nutzgarten finde ich allerdings den größeren naturnahen Teil des über 1000 Quadratmeter großen Gartens mit Kräuterspirale, einem kleinen Wasserlauf mit Teich, Sumpfbeet, vielen idyllischen Sitzgelegenheiten und einer Gartenlaube, die mein Herz höherschlagen lässt.
Gerne würde ich bleiben, mich irgendwo hinsetzen, mein Tagebuch auspacken und schreiben, aber leider spielt das Wetter nicht wirklich mit: Das erste Wochenende nach dem meteorologischen Sommeranfang ist nicht wirklich sommerlich warm, und wir waren eben leider auch nicht die einzigen BesucherInnen.
Der Garten von Sabine Sundermeyer und Joachim von Kortzfleisch blüht wahrscheinlich erst in den nächsten Tagen richtig auf. Denn um das alte Bauernhaus leben 45 Rosensorten, Stauden, Kräuter und Zwiebelblumen in farblich abgestimmten Beeten – und die Rosenblüte beginnt in diesem Jahr später als in den vergangenen. Ein kleines (Gesamt)Kunstwerk ist der Garten trotzdem, auch weil in den Beeten, im Bienengarten und an den Hauswänden der hannoverschen Künstler Bernd Sidon seine Werke ausstellt. Die sollen nicht fotografiert werden – was die Foto-Auswahl einschränkt.
Viel jünger als die beiden ersten Gärten ist Garten Nummer drei. Im Garten Sickau wachsen vor allem Hosta und Stauden, Rosen und Clematis, die leider noch nicht blühen. Pflanzen halten sich eben nicht an (Veranstaltungs)Kalender. Es gibt einen kleinen Kräuter- und Beerengarten, zwei Teiche, lauschige Sitzecken.
Ich bewundere nicht nur die Pflanzen, sondern auch die Dinge, die den Garten schmücken, ihm seinen besonderen Reiz verleihen – die alten Gartenmöbel zum Beispiel, das Fahrrad, das wie vergessen am Zaun lehnt, oder die Echse am Teich. Und wieder einmal wird mir klar: Mir fehlt leider nicht nur der grüne Daumen, sondern auch der Sinn für Dekorationen.
Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf – und ich werde mir weiter Tipps und Anregungen holen. Schon an diesem Wochenende, in anderen Gärten, die noch bis Oktober ihre Pforten für Gartenfans wie mich öffnen.