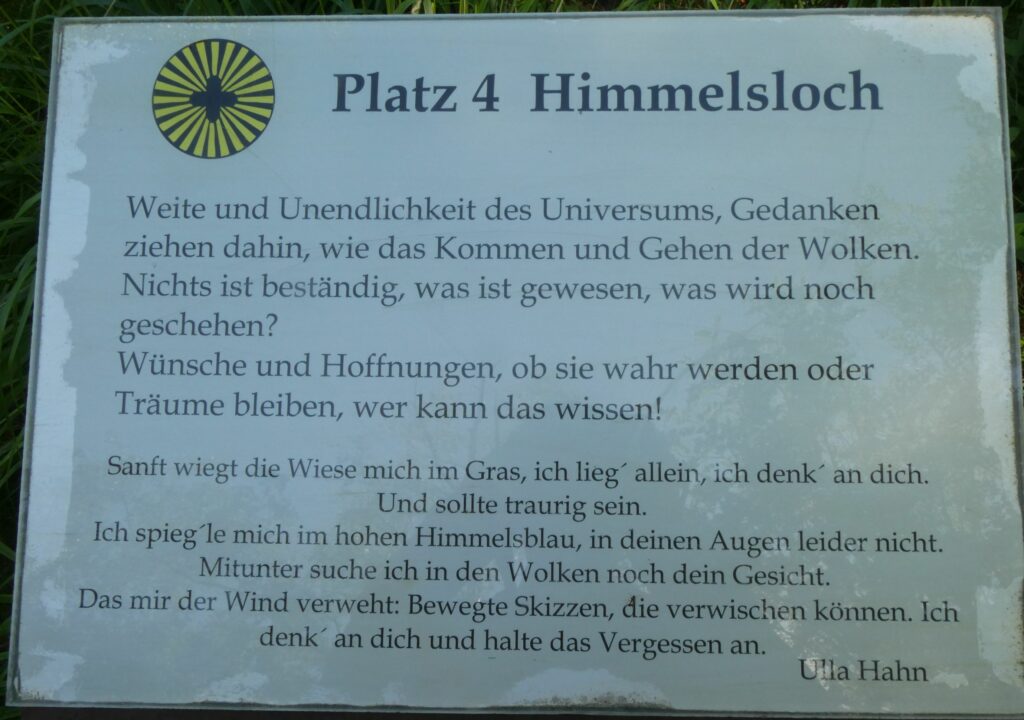Ich gebe zu: Die gar nicht mehr so neuen Bundesländer sind für mich immer noch weitgehend Terra incognita. Natürlich war ich in den vergangenen 35 Jahren schon an manchen Orten, am häufigsten an der Ostsee, auf dem Darß und auf Usedom. Ich bin im Elbsandsteingebirge und vor allem im Harz gewandert. Ich war in Dresden, Leipzig und in Potsdam. Mein Besuch in Weimar war bislang der einzige im „Freistaat Thüringen“, obwohl geschichtsträchtige Städte wie Gotha, Mühlhausen, Erfurt oder Eisenach quasi direkt vor der Haustür liegen und mit dem Nahverkehrszug und mit dem 49-Euro-Ticket recht gut zu erreichen sind. Also auf nach Thüringen, solange es noch geht. Solange es das Deutschlandticket noch gibt und die AfD in Thüringen noch nicht an der Macht ist.

Ob Gotha oder Erfurt hatte ich noch nicht entschieden, als ich morgens in den Zug stieg. Beide sollen zu den schönsten Städten Thüringens zählen. Doch weil mir der Sinn eher nach beschaulicher Residenz- als nach lebhafter Landeshauptstadt stand, bin ich in Gotha ausgestiegen. Auch dass dort in der Gaststätte Tivoli im Jahr 1875 die Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands (SAP), die heutige SPD, gegründet wurde, sprach für die Stadt.
Hoch über der Altstadt thront Schloss Friedenstein, laut Wikipedia der größte frühbarocke Feudalbau in Deutschland. Herzog Ernst I. von Sachsen-Gotha, genannt „Ernst der Fromme“ ließ das Schloss ab 1643 bauen, weil „sich in der Stadt keine geeignete Residenz befand“ (https://de.wikipedia.org/wiki/Schloss_Friedenstein). Und weil der Herzog offenbar ein früher Fan des Homeoffice war, entstanden im Schloss nicht nur Wohn- und Repräsentationsräume, sondern auch Verwaltungs- und Wirtschaftsräume, Zeughaus, Kirche und Münzstätte. Sein Nachfolger Herzog Friedrich I. von Sachsen-Gotha-Altenburg funktionierte den Ballsaal des Schlosses dann zu einem Theater um (https://de.wikipedia.org/wiki/Ekhof-Theater).
Die Herzöge waren offenbar sehr an Kunst und (Natur)Wissenschaften interessiert. Herzog. Ernst II. Ludwig von Sachsen-Gotha-Altenburg zahlte Ende des 18. Jahrhunderts den Schauspielern seines Theaters nicht nur ein festes Gehalt, sondern richtete sogar eine Pensionskasse für sie ein. Weitere hundert Jahre später waren dann die diversen herzoglichen Sammlungen so groß, dass ein anderer Ernst, nämlich Herzog Ernst II. von Sachsen-Coburg und Gotha, ein Museum bauen ließ, das am Wochenende alle besuchen konnten, ohne Eintritt bezahlen zu müssen (https://de.wikipedia.org/wiki/Herzogliches_Museum_Gotha).


Ich habe zugegebenerweise weder Museum noch Theater noch Schloss besichtigt, sondern bin direkt in Richtung Altstadt gegangen und habe die Wasserkunst bewundert. Die 1895 eingeweihte Wasserspiel- und Brunnenanlage verbindet Schloss und Marktplatz und ist nicht nur eine der Haupt-Sehenswürdigkeiten Gothas, sondern Teil eines ausgeklügelten Wasserversorgungssystems.



Weil es in Gotha keinen Fluss gibt und Brunnen schon im Mittelalter nicht mehr ausreichten, um den Wasserbedarf zu decken, ließ Landgraf Balthasar in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts den Leinakanal bauen. Durch ihn wurde das Wasser aus dem Thüringer Wald in die Stadt geleitet und mit einem hölzernen Pumpwerk bis aufs Schloss gepumpt.



Von der Wasserkunst hat man einen schönen Blick auf den Marktplatz und das Alte Rathaus, noch besser ist der Ausblick vom Rathausturm über die Stadt und die Umgebung.



Wieder zurück auf dem Boden, bin ich durch die Altstadt mit vielen hübsch restaurierten Häusern spaziert – und natürlich durch den Schlosspark und die Orangerie. Die spätbarocke Orangerie, die größte Thüringens, wurde im 18. Jahrhundert angelegt, um exotische Pflanzen zu sammeln, zu züchten und zu zeigen. Über 600 Orangen-, 300 Lorbeer- und fast ebenso viele Zitronenbäume standen damals dort (https://de.wikipedia.org/wiki/Orangerie_Gotha). Anfang des 20. Jahrhunderts wurde die Orangerie aufgegeben, jetzt wird der Bestand an Kübelpflanzen schrittweise wieder aufgebaut. Ich bin gespannt.


Auf der Rückfahrt habe ich dann in Mühlhausen Station gemacht. Irgendwie war der Stopp in der Stadt, die bis 1991 auch Thomas-Müntzer-Stadt hieß, auch ein Abstecher in die Vergangenheit. Denn im Studium habe ich mich intensiv mit dem Reformator Thomas Müntzer beschäftigt, der sich, anders als Martin Luther, nicht auf die Seite der Obrigkeit stellte, sondern den Kampf der Bauern um Freiheit und soziale Gerechtigkeit unterstützte. Als Prediger in der Marienkirche machten er und sein Mitstreiter Heinrich Pfeiffer Mühlhausen zum Zentrum der radikalreformatorischen Bewegung. Für sein Engagement zahlt Müntzer einen hohen Preis: Er wurde bei der Schlacht von Frankenhausen gefangen, gefoltert und in Mühlhausen hingerichtet.



Natürlich habe ich die Thomas-Müntzer-Gedenkstätte in der Marienkirche besucht und das Bauernkriegsmuseum in der Kornmarktkirche. St. Crucis ist übrigens nur eine von insgesamt zwölf mittelalterlichen Kirchbauten in Mühlhausen. Mit dem Bau der Kornmarktkirche wurde 13. Jahrhundert begonnen. Fast ebenso alt ist die dritte Kirche, die ich in Mühlhausen besucht habe: In der Divi-Blasii-Kirche arbeitete Johann Sebastian Bach, einer meiner Lieblingskomponisten, von Juli 1707 bis Juli 1708 als Organist. Bis zum 20. September ist dort übrigens eine Ausstellung über die Synagogen in Thüringen zu sehen, die am 9. November 1938 von den Nazis zerstört wurden. Bilder des Fotografen Jan Kobel zeigen, wo die 32 Synagogen standen und wie die Grundstücke heute genutzt werden. Texte von Judith Rüber informieren über die Bedeutung jüdischen Lebens in Thüringen. Auch – aber nicht nur deshalb – hat sich der Besuch der Thomas-Müntzer-Stadt gelohnt.