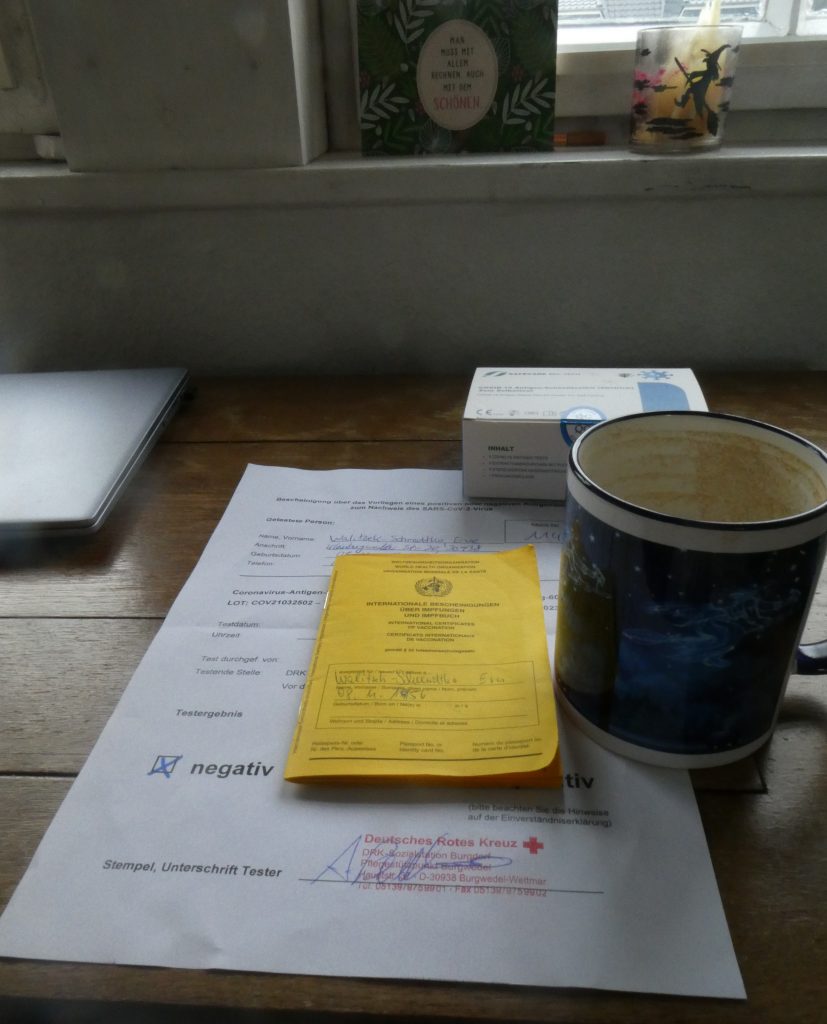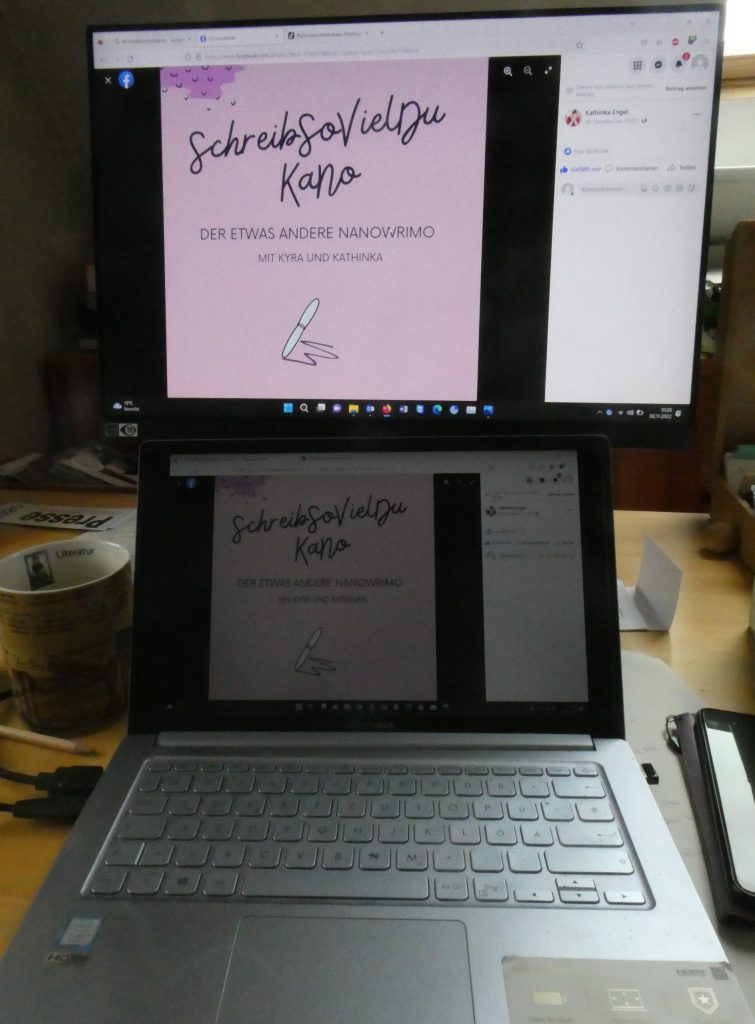Manchmal erweisen sich Entscheidungen als goldrichtig. Zum Beispiel die, am Freitag nach Bad Harzburg zu fahren. Und das Nützliche, eine berufliche Besprechung, mit dem Angenehmen, einer kurzen Wanderung, zu verbinden. Weil meine Kollegin Schnee liebt, sind wir ein paar Kilometer Richtung Brocken gefahren – und in einem Winterwunderland gelandet.

Ich bin immer wieder erstaunt, wie sehr ein paar Zentimeter Schnee und natürlich ein paar Sonnenstrahlen die Landschaft verändern, ja verzaubern. Den Weg um den Oderteich fand ich ziemlich deprimierend, als ich die letzten Male dort gewandert bin. Ringsum viele tote Bäume, kaputte Wege, habe ich in meinem Blogbeitrag vom 18. Mai 2018 geschrieben. Und weiter: „Der Bohlenweg ist in einem beklagenswerten Zustand: Umgestürzte Bäume haben die Planken teilweise unter sich begraben und versperren den Weg. Noch trauriger ist der Zustand des Waldes. Viele Bäume sind vom Borkenkäfer befallen und abgestorben, die Winterstürme hatten leichtes Spiel und haben viele Baumriesen entwurzelt. Zwischen den Baumgerippen zu wandern, hatte etwas Gespenstisches.“ (https://timetofly.4lima.de/wandern-im-harz-hexenstieg-teil-i)
Tief verschneit sah alles viel freundlicher aus, wie die Fotos zeigen, die mir meine Kollegin Foe zur Verfügung gestellt hat. Weil ich nämlich nach dem Grau in Grau der letzten Tage im norddeutschen Tiefland nicht mit so schönem Wetter und so tollen Impressionen gerechnet habe, hatte ich morgens, als ich in den Harz fuhr, keine Kamera eingepackt und konnte nur mit meinem Smartphone fotografieren.



Auf dem Rückweg haben wir dann noch auf der anderen Seite des Brockens Station gemacht und bevor die Sonne endgültig verschwand, noch einen kurzen Spaziergang zum Marienteich gemacht.

Übrigens: In meinem letzten Blogbeitrag habe ich ja noch darüber nachgedacht, ob sich der Kauf der Bahncard für mich rechnet. Jetzt weiß ich die Antwort: Ja. Denn Eindrücke und Erlebnisse wie die bei unserem kurzen Ausflug lassen sich eben nicht mit Geld bezahlen. Und ohne die Bahncard wäre ich vielleicht nicht für ein paar Stunden nach Bad Harzburg gefahren.
Mehr Fotos von unserem gemeinsamen Ausflug und viele andere tolle Fotos gibt es auf dem Blog von Foe Rodens (https://foerodens.wordpress.com/2022/12/11/gewohnheitstier/) und in ihrem Redbubble-Shop (https://www.redbubble.com/de/people/FoeRodens/explore?asc=u&page=1&sortOrder=recent).